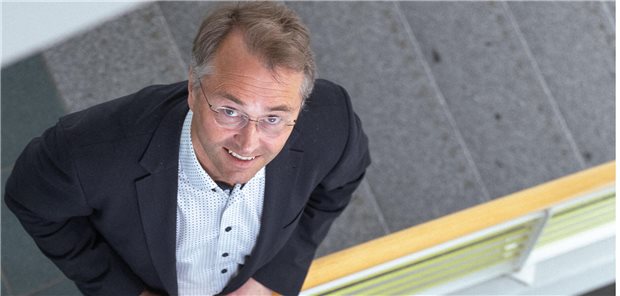US-Psychologe Kirsch im Interview
Kontroverse zum Nutzen von Antidepressiva
Seine Metaanalysen sorgten für viel Aufsehen, die Wirksamkeit von Antidepressiva nennt er einen Mythos. Die Thesen des in New York geborenen Psychologen Professor Irving Kirsch fanden in einer Presidential Debate beim DGPPN-Kongress in Berlin erwartungsgemäß nicht nur Zuspruch. Im Interview mit der "Ärzte Zeitung" fand Kirsch kritische Worte zu den Methoden, mit denen der Nutzen von Antidepressiva bewertet wird.
Veröffentlicht:Professor Irving Kirsch

© Thomas Müller
Irving Kirsch ist Professor für Psychologie an der Universität in Plymouth, Großbritannien, emeritierter Professor für Psychologie an der Universität in Hull, ebenfalls Großbritannien, sowie der Universität von Connecticut in den USA. Er ist zudem Dozent für Medizin an der Harvard Medical School in Boston und dort Direktor des "Program in Placebo Studies".
Der in New York geborene Psychologe bekam viel Aufmerksamkeit für seine Metaanalysen, nach denen die Wirksamkeit von Antidepressiva zum größten Teil auf dem Placeboeffekt beruht, sowie für sein Buch "The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth".
Während einer Presidential Debate mit Professor Irving Kirsch beim DGPPN-Kongress in Berlin sprach der Pharmakologe Professor Elias Erikkson aus Göteborg von einer "Erfolgsstory" der Antidepressiva.
So sei die antidepressive Wirkung von Imipramin unbeabsichtigt entdeckt worden und lasse sich daher nicht bloß auf die Erwartungshaltung der Patienten zurückführen. Erikkson sieht auch in der unterschiedlich starken Wirksamkeit von Trizyklika, SSRI und SNRI einen klaren Hinweis auf einen Nutzen.
Das konterte Kirsch mit einer Analyse, nach der Antidepressiva am besten in direkten Vergleichsstudien wirken: Hier wird ein Rückgang um durchschnittlich 15 Punkte im Hamilton-Score beobachtet, in Placebo-kontrollierten Studien jedoch nur noch von elf Punkten in der Gruppe mit dem Antidepressivum.
Die Erklärung des Psychologen: Der Placeboeffekt ist am größten, wenn alle Teilnehmer wissen, dass sie ein Antidepressivum bekommen, und schon etwas weniger ausgeprägt, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie sich im Placeboarm befinden.
Unter Alltagsbedingungen, wenn also nicht ein Großteil der Patienten im Voraus ausgeschlossen wird, sei die Wirkung sogar noch viel schlechter. So sei in der Studie STAR*D mit Antidepressiva nur noch ein Rückgang von etwa sechs Punkten beobachtet worden, sagte Kirsch.
Kirsch hält nicht viel von Antidepressiva
Dagegen verwies Professor Hans-Jürgen Möller aus München auf eine deutsche Praxisstudie mit Escitalopram, in deren Verlauf 70 Prozent der Patienten auf die Therapie ansprachen und 57 Prozent in Remission gelangten.
Die Mehrheit der Patienten hatte zu Beginn eine schwere Depression. Dies zeige, so Möller, dass Antidepressiva durchaus unter Alltagsbedingungen eine gute Wirkung entfalten.
Der Psychiater kritisierte auch das Konzept der Metaanalyse: Wenn alle möglichen unterschiedlichen Studien in einen Topf geworfen werden, dann erhält man vor allem viel Rauschen und sieht relevante Unterschiede oft nicht mehr."
Für den Psychiater sind die positiven Effekte in den Placebogruppen auch nicht nur durch die Erwartungshaltung der Patienten zu verstehen, sondern auch durch Ko-Therapien mit Anxiolytika, Hypnotika und begleitenden Psychotherapien, die ebenfalls zur Reduktion der Symptome und damit der Placebo-Verum-Differenz beitragen.
Wann würde bei der aktuellen Datenlage aber auch der Psychologe Kirsch die Verordnung eines Antidepressivums befürworten? Und wie steht er genau zu den Methoden, mit denen der Nutzen von Antidespressiva bewertet wird? Die "Ärzte Zeitung" fragte nach:
Ärzte Zeitung: Wann würden Sie ein Antidepressivum empfehlen?
Professor Irving Kirsch: Erst dann, wenn andere Methoden versagen. Denn bei leichter bis moderater Depression gibt es überhaupt keine Evidenz für einen klinischen Nutzen, selbst bei schwerer Depression profitieren nur Patienten mit hohem Hamilton-Depressions-Score, also mit 27 Punkten oder darüber. Ab hier macht sich im Vergleich zu Placebo ein Unterschied von mindestens drei Punkten bemerkbar, wie ihn das NICE als klinisch signifikant definiert.
Eine klinisch signifikante Wirksamkeit von Antidepressiva scheint es also nur bei schwer Depressiven zu geben, wenngleich auch hier der Unterschied zu Placebo immer noch relativ gering ist. Da es bei allen Schweregraden einer Depression weniger riskante Alternativen gibt, würde ich Antidepressiva als Reservetherapie zurückhalten.
Also stets eine Psychotherapie bei leichter bis moderater Depression?
Kirsch: Nicht nur bei leichter bis moderater Depression. Ich würde generell als erste Therapie etwas anderes als ein Antidepressivum bevorzugen. Denn die Evidenz, die wir bislang haben, zeigt, dass alle aktiven Behandlungen vergleichbar effektiv sind, auch bei schwerer Depression. Wenn nun alle Therapien etwa gleich wirksam sind, dann sollte man diejenige mit der besten Sicherheit wählen. Und hier stehen Antidepressiva an letzter Stelle.
Aber es gibt auch noch andere Alternativen als eine Psychotherapie, zum Beispiel körperliche Bewegung. Hier ist das Nebenwirkungsprofil geradezu fantastisch. Eigentlich müsste man Trainingsprogramme allein schon wegen all der gesundheitsfördernden Nebenwirkungen verschreiben.
Betrachtet man nicht nur die Werte auf der Hamilton-Depressions-Skala, sondern die Ansprechraten, ergibt sich da für Antidepressiva nicht ein günstigeres Bild?
Kirsch: Die Responderraten basieren letztlich auf dem HAMD-Score, sie dichotomisieren nur einen kontinuierlichen Score. Jeder Statistiker würde sagen, das ist schlechte Statistik: Sie legen jemanden, der nur zu 50 Prozent anspricht, mit jemandem zusammen, der 100-prozentig anspricht. Auf der anderen Seite kommt ein Patient mit 49-prozentiger Antwort in dieselbe Gruppe wie einer, der überhaupt nicht auf die Therapie reagiert. Dadurch wird ein Großteil der Daten nicht berücksichtigt.
Die Ansprechrate täuscht zudem größere Unterschiede vor, als tatsächlich auftreten: Jemand mit 50-prozentiger Symptomreduktion unterscheidet sich plötzlich von jemandem mit 49-prozentiger Reduktion. Viele, die als Responder klassifiziert werden, differieren nur um ein oder zwei Punkte von Non-Respondern. Statistiker sind der Auffassung, wenn man schon eine kontinuierliche Skala hat, sollte man keine dichotomen Ansprechraten verwenden, sondern auf das exakte Ausmaß der Veränderung achten.
Nun spricht nicht jeder auf ein Medikament gleich gut an. Beim einen wirkt es prima, bei anderen gar nicht. Das bildet sich im Mittelwert kaum ab. Gibt es hier keine besseren Methoden?
Kirsch: Bislang hat keiner eine bessere Methode gefunden als Veränderungen bei der Schwere der Erkrankung zu messen. Aber wenn es im Vergleich zu Placebo kaum Unterschiede gibt, wie es mit Antidepressiva bei leichter und moderater Depression der Fall ist, und trotzdem einige Patienten sehr gut davon profitieren, muss es natürlich auf der anderen Seite auch Patienten geben, denen die Therapie schadet.
Das komplette Interview lesen Sie exklusiv in unserer App-Ausgabe vom 13.12.2013.