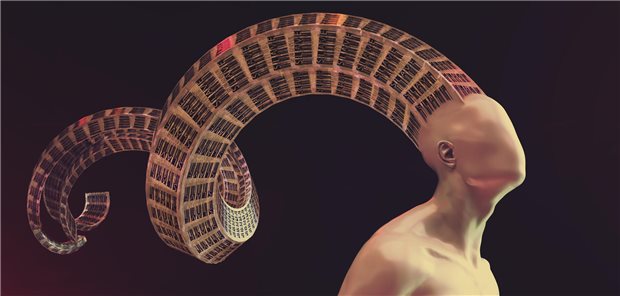Antidepressiva
Schaden SSRI in der Schwangerschaft?
Zwei aktuelle Studien und eine Metaanalyse finden keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen bei Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft SSRI erhalten haben. Lediglich Frühgeburten scheinen etwas häufiger aufzutreten.
Veröffentlicht:BLOOMINGTON Es ist eine vertrackte Situation: Kinder von Schwangeren unter SSRI zeigen vermehrt Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS, doch liegt dies an den Medikamenten, der Depression der Mutter oder gemeinsamen genetischen Risikofaktoren solcher psychischer Krankheiten?
Für alle Möglichkeiten gibt es plausible Erklärungen. So ist Serotonin ein wichtiger neurotropher Signalgeber in kritischen Schritten der Hirnentwicklung. Ein Eingriff in den Serotoninstoffwechsel zur ungünstigen Zeit könnte daher unbeabsichtigte Folgen haben.
Auf der anderen Seite führt die Depression der Mutter zur Ausschüttung von Stresshormonen, die ebenfalls Hirnentwicklung und psychische Gesundheit des Nachwuchses beeinflussen. Und schließlich gibt es Untersuchungen, wonach Angehörige von Autismuskranken dreifach häufiger depressiv werden als solche ohne. Es ist also nicht einfach, Ursache, Wirkung und Begleitfaktoren auseinanderzuhalten.
In zwei neuen Studien wurde dies dennoch versucht, und in beiden haben Forscher nach allerlei Korrekturen für mögliche Fehlerquellen keinen Zusammenhang zwischen SSRI-Exposition und ADHS oder Autismus gefunden.
Alles nur Indikationsbias?
In einer der Studien hat ein Team um Dr. Hilary Brown vom College Hospital in Toronto Angaben zu knapp 36.000 Kindern ausgewertet, die zwischen 2002 und 2010 in der Provinz Ontario zur Welt gekommen sind und deren Mütter die Kriterien für die öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung erfüllten – sie hatten beispielsweise ein geringes Einkommen oder Behinderungen (JAMA 2017; 317: 1544-1552).
Bei diesen Müttern ließ sich feststellen, welche Medikamente sie in der Schwangerschaft bekommen hatten. Rund 2840 der Kinder (7,9 Prozent) stammten von Müttern, die während der Schwangerschaft mindestens zwei SSRI- oder SNRI-Rezepte erhalten hatten.
Bis zum Jahr 2014 waren insgesamt 1,1 Prozent aller Kinder der Kohorte an einer Autismusstörung erkrankt – solche mit Antidepressiva-Exposition waren zweieinhalbfach häufiger betroffen. Insofern bestätigten die Daten den bekannten Zusammenhang. Je mehr Begleitfaktoren die Forscher jedoch berücksichtigten, umso schwächer wurde die Assoziation. Verwendeten sie schließlich einen hochdimensionalen Propensity-Score, gab es keinen signifikanten Unterschied mehr.
In diesen Score flossen sämtliche andere Diagnosen der Mütter mit ein, auch die Zahl der Klinikeinweisungen, Arztbesuche und medizinischen Eingriffe. Letztlich sollen damit auch noch unbekannte oder schlecht zu erfassende Verzerrungen indirekt einbezogen werden, etwa die Schwere der Depression. Wurde die Exposition nach einzelnen Trimestern stratifiziert, zeigten sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, die gab es auch nicht zwischen exponierten und nicht exponierten Geschwistern, was ebenfalls gegen eine Bedeutung von SSRI bei der Autismusentstehung spricht.
Zudem war die Autismusrate auch bei solchen Kindern erhöht, deren Mütter vor, aber nicht während der Schwangerschaft Antidepressiva bekamen. All das spreche doch sehr für einen Indikationsbias, schreiben Brown und ihre Kollegen. Offenbar erhöhen doch eher die Depression und die damit verbundene Genetik das Autismusrisiko, nicht die Antidepressiva.
Kein Unterschied bei Geschwistern
Zu einem ähnlichen Schluss kommen Forscher um Dr. Ayesha Sujan von der Universität in Bloomington nach der Auswertung schwedischer Registerdaten zu über 1,5 Millionen Geburten (JAMA 2017; 317: 1553-1562). Von den Müttern gaben etwa 22.500 (1,4 Prozent) an, während der Schwangerschaft Antidepressiva genommen zu haben, zu 80 Prozent waren dies SSRI.
Bei 12,6 Prozent der Kinder mit Antidepressiva-Exposition und bei 5,5 Prozent ohne wurde bis zum 15. Lebensjahr ein ADHS festgestellt, jeweils 5,3 und 2,1 Prozent bekamen eine Autismusdiagnose. Auch hier traten bei den exponierten Kindern solche Störungen folglich zwei- bis dreifach häufiger auf als bei nicht exponierten. Verglichen die Forscher um Sujan hier Geschwister, sahen sie ebenfalls keine Unterschiede bei der ADHS- und Autismusrate zwischen solchen mit- und ohne Antidepressiva-Exposition. Auch das ist ein starkes Argument für Umweltfaktoren – etwa maternaler Stress – und/oder genetische Gründe als Ursache für die Risikoerhöhung.
Immerhin war beim Geschwistervergleich die Frühgeburtenrate von exponierten Kindern um ein Drittel erhöht – ganz harmlos scheinen SSRI also nicht zu sein.
SSRI besser nicht absetzen?
Aufschlussreich ist auch eine aktuelle Metaanalyse eines Teams um Dr. Antonia Mezzacappa von der Uniklinik in Le Kremlin-Bicêtre (JAMA Pediatr 2017, online 17. April). Sie fanden zehn Studien zum Thema Autismus und pränatale SSRI-Exposition – die beiden aktuellen Arbeiten noch nicht eingeschlossen.
Sechs Fall-Kontroll-Studien ergaben unterm Strich ein etwa verdoppeltes Autismusrisiko bei einer Antidepressiva-Exposition, der Zusammenhang schwächte sich wiederum deutlich ab, wurde eine Depression in der Vergangenheit berücksichtigt.
Das Risiko schien jedoch noch größer zu sein, wenn die Mütter die Antidepressiva vor, und nicht während der Schwangerschaft genommen hatten, was die Studienautoren wiederum als Indikationsbias interpretieren, zumal zwei große Kohortenstudien nach diversen Adjustierungen für Risikofaktoren keinen Zusammenhang zwischen Antidepressiva-Exposition und Autismus erkennen konnten.
Die Resultate der Metaanalyse sowie der beiden Registerstudien sind insofern relevant, als viele Schwangere nach Berichten über ein erhöhtes Autismusrisiko SSRI abgesetzt oder gar nicht erst eingenommen haben. Möglicherweise haben sie dadurch die Autismusgefahr erst recht erhöht.