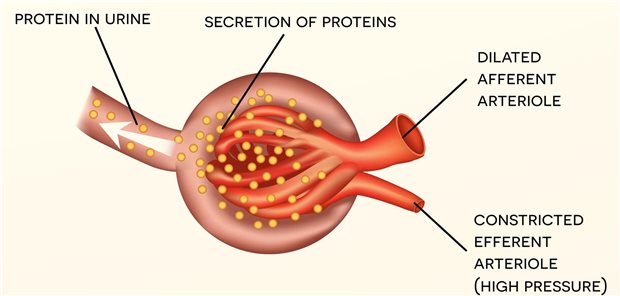Interview mit Rheuma-Experten
"Abzuwarten schadet dem Patienten"
Orthopäden sollen maßgeblich dazu beitragen, entzündlich-rheumatische Krankheiten früh zu erkennen, fordert Professor Wolfgang Rüther. Zugleich warnt er vor einem Glauben an die "Allmacht des Medikaments".
Veröffentlicht:Professor Dr. Wolfgang Rüther

© Prof. Wolfgang Rüther
Aktuelle Position: Direktor der Klinik für Orthopädie und Orthopädische Rheumatologie am Klinikum Bad Bramstedt und Direktor der Klinik für Orthopädie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Werdegang: 1970-1976 Medizin- und Psychologiestudium in Mainz und Bonn; danach Ausbildung zum Arzt für Orthopädie an der Bonner Uniklinik; 1985 Ernennung zum Oberarzt; 1987 Habilitation; 1988 Wechsel an die Rheumaklinik Bad Bramstedt; 1991 Ernennung zum C3-Professor an der Uniklinik Düsseldorf; seit 1996 Ordinarius für Orthopädie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf
Engagement: 2004-2010 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie (DGORh), 2009 und 2010 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh), Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)
Ärzte Zeitung: Herr Professor Rüther, in den vergangenen Jahren haben sich die medikamentösen Behandlungsoptionen bei rheumakranken Patienten dramatisch verändert. Hat dies die Arbeit orthopädischer Rheumatologen beeinflusst?
Professor Wolfgang Rüther: Ja! Aus internationalen Statistiken geht hervor, dass die Zahl der durch das entzündliche Rheuma notwendigen Endoprothesen-Implantationen deutlich kleiner geworden ist, vor allem bei den 20- bis 40-Jährigen.
Gleiches gilt in den vergangenen etwa sieben Jahren für die prophylaktischen Synovialektomien. Ich schätze, deren Zahl hat sich mehr als halbiert.
Was heißt das für die Praxis des orthopädischen Rheumatologen?
Rüther: Weil die modernen Arzneimittel so effizient wirken, weil die Entzündung so gut kontrollierbar und der langfristige Erfolg gesichert erscheinen, ist es umso bedeutsamer, diese entzündlichen Gelenkkrankheiten früh zu erkennen.
Neben der nicht-operativen Therapie, wie zum Beispiel der Hilfsmittelversorgung, und der chirurgischen Behandlung sehen wir orthopädischen Rheumatologen daher die Früherkennung und die Primärdiagnostik als eine wesentliche Aufgabe an.
Je früher die Diagnose, desto größer sind die Langzeiterfolge. Wir können es uns einfach nicht mehr erlauben, mehrere Wochen oder gar Monate mit einer abwartenden Haltung zu verlieren, denn das würde einen deutlichen Schaden für den Patienten bedeuten.
Also ein neuer Aufgabenschwerpunkt für Orthopäden?
Rüther: So ist es. Wir haben in Deutschland ungefähr 450 niedergelassene internistische Rheumatologen und etwa 6000 Orthopäden. Wir von der Deutschen Gesellschaft für orthopädische Rheumatologie (DGORh) wollen, dass alle Orthopäden verstärkt ihr Augenmerk darauf legen, entzündliche Gelenkerkrankungen früh zu entdecken.
Der Berufsverband Deutscher Orthopäden hat vor zwei Jahren eine bundesweite Kampagne gestartet, um das Augenmerk der Orthopäden auf die Optionen der modernen Diagnostik und Therapie zu lenken.
Wie viele orthopädische Rheumatologen gibt es denn?
Rüther: Es sind genauso viele niedergelassene orthopädische wie internistische Rheumatologen. Wir Orthopäden verdoppeln also die vielfach kolportierte Zahl der in Deutschland tätigen Rheumatologen, wohl wissend, dass die medikamentöse Behandlung nicht in unserem zentralen Fokus steht.
Die Orthopäden arbeiten also ihren internistischen Kollegen zu?
Rüther: Der Orthopäde arbeitet dem Internisten zu und umgekehrt. Beide Fachdisziplinen arbeiten komplementär, jeder hat seine eigenen Schwerpunkte. Wissen Sie, wir alle sind froh, dass wir die neuen Medikamente haben. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass der Glaube an die Allmacht des Medikamentes wieder zurückkehrt. Ich überblicke 25 Jahre in der Rheumatologie, wir hatten das schon einmal und ich warne davor.
Wir müssen bei den Patienten genau hinschauen: Was passiert an jedem Gelenk? Es hat keinen Sinn, vielfach die Medikamente zu wechseln und die Dosis immer weiter zu erhöhen. Ich bitte darauf zu achten: Sind wirklich alle Gelenke gut im Griff? Bedarf es einer zusätzlichen lokalen Therapie? Bei einzelnen problematischen Gelenken sollte stets auch der Operateur gefragt werden, ob er positiv intervenieren kann.
Beim diesjährigen DGORh-Jahreskongress war allerdings dazu aufgerufen worden, die konservative Therapie zu stärken. Warum?
Rüther: Die Zusammenführung der Orthopädie und Unfallchirurgie zu einem gemeinsamen Facharzt vor einigen Jahren hatte die Konsequenz, dass in den Ausbildungskliniken die operative Therapie zwangsläufig stärker in den Vordergrund gerückt ist. Vor allem aus versorgungsstrukturellen Gründen können im Moment die konservativen Behandlungsoptionen nicht mehr ausgebildet und gelehrt werden.
Und die niedergelassenen Kollegen können nur begrenzt einen Beitrag zur Facharztausbildung leisten. Deshalb wollen die orthopädisch-unfallchirurgischen Fachgesellschaften die konservativen Therapieaspekte in der Fortbildung deutlich verstärken und unter dem Dach der orthopädischen Rheumatologie zusammenführen. Unter Rheumatologie verstehen wir dabei nicht nur die chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankungen, laut WHO gehören auch die degenerativen Gelenkkrankheiten zur Rheumatologie.
Nun unterscheidet sich ein chirurgischer Eingriff bei einem Patienten mit chronisch-entzündlicher Gelenkkrankheit von einer Operation bei degenerativer Gelenkkrankheit. Wie klären Sie diese Patienten auf?
Rüther: Bei entzündlich-rheumatischen Gelenkkrankheiten ist das Risiko für Wundheilungsstörungen sowie das Infektionsrisiko erhöht. Die Knochensubstanz dieser Patienten ist durch die Krankheit selbst und aufgrund einer jahrelangen Steroidbehandlung sowie der relativen Immobilität viel weicher und spröder als bei Patienten ohne diese Grunderkrankung.
Die Vitalität, die Regenerationsfähigkeit des Knochens ist eine völlig andere mit entsprechenden Auswirkungen auf die mechanische Stabilität. Die Gefahr von Knochenfrakturen unter der Operation ist deutlich größer. Wegen der im Altersvergleich verringerten Knochenqualität wählen wir bei diesen Patienten häufig zementierte Endoprothesenvarianten.
Die noch jungen Patienten unter 50 Jahren profitieren leider nicht von der heute sonst vielfach anwendbaren Option miniaturisierter Prothesen, also zum Beispiel Kurzstielprothesen an der Hüfte oder dem Gelenkteilersatz am Knie.
Und wie besprechen Sie die Erfolgschancen?
Rüther: Wir müssen bei jedem Patienten, der sich eine primäre Endoprothese implantieren lässt, überlegen, was passiert, wenn diese Endoprothese irgendwann gewechselt werden muss. Die Standzeiten solcher Endoprothesen sind bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Krankheiten vergleichsweise kürzer.
Einflusskriterien sind das Geschlecht, die Medikation, der Zustand des Knochens zum Zeitpunkt der Operation und viele weitere Parameter. Genaue Prognosen zu den Standzeiten können wir im Einzelfall nicht abgeben.
Ab wann ist ein chirurgischer Eingriff beim Patienten mit entzündlich-rheumatischer Gelenkerkrankung obligat?
Rüther: Das, was die meisten Patienten zur Operation bringt, sind die unerträglichen Schmerzen. Dennoch möchte ich betonen, dass jede Endoprothesenoperation eine Elektivoperation ist. Es gibt kein Muss! Ich lege wirklich wert darauf, dies den Patienten auch zu sagen. Mein Eindruck ist, dass vielfach Patienten geradezu zu Endoprothesenoperationen gedrängt werden.
Zwar geht die Operation oft mit großen Vorteilen für die Mobilität einher, an Schulter-, Hüft- und Kniegelenk können wir heute Hervorragendes leisten. Dennoch müssen wir den Patienten die Wahl lassen. Nicht jede Operation geht gut aus, die Infektionsraten liegen nach wie vor bei knapp einem Prozent.
An einem großen Klinikum wie dem unseren bedeutet das, dass jedes Jahr 10 bis 15 Patienten postoperativ Infektionen erleiden. Für die Betroffenen ist das sehr bitter! Deshalb müssen wir unseren Patienten die Chance lassen, sich das gut zu überlegen.
Wirken sich die modernen Biologika auf die Erfolgschancen gelenkersetzender Eingriffe aus?
Rüther: Das ist eine offene Frage. Ich glaube, dass sie sich nicht negativ auf die Standzeiten von Endoprothesen auswirken, ob sie sich positiv auswirken, ist unbekannt. Wichtig ist, dass die hochpotenten Biologika den Operationserfolg gefährden können, wenn sie perioperativ nicht strikt abgesetzt werden. Das ist international Konsens, wenngleich diese Empfehlung hauptsächlich auf Erfahrung, kaum auf Daten beruht.
Wie gehen Sie bei Patienten mit multiplem Gelenkbefall vor?
Rüther: Es werden Prioritäten gesetzt: Bein kommt vor Arm und an der jeweiligen Extremität kommt das am meisten proximale Gelenk zuerst, also Hüft- vor Knie- vor Sprunggelenk. Wenn Sie am Arm eine funktionsgestörte Hand und eine funktionsgestörte Schulter vorliegen haben, ist es sinnvoll, zunächst die Schulter zu operieren.
Denn eine gut funktionierende Hand hilft wenig, wenn die Hand nicht an die Stelle gebracht werden kann, wo sie gebraucht wird. Wir denken also immer von der Funktion her.
Sie sprachen vorhin die Synovialektomie an, deren Häufigkeit deutlich abgenommen habe. Wann besteht heute noch eine Indikation dazu?
Rüther: Es scheint Patienten zu geben, denen es zwar insgesamt unter der medikamentösen Behandlung gut geht und deren Laborparameter gut aussehen, die an einigen Stellen jedoch fortbestehende Entzündungsaktivität zeigen. Nicht selten sehen wir Patienten, die mit ihrem Biologikum recht glücklich sind, aber ein Gelenk bleibt übrig, das unverändert schmerzt.
Warum das so ist, haben wir noch nicht verstanden, das ist Gegenstand der Forschung. Wenn wir ein solches "rebellisches Gelenk" entdecken, ist das eine klare Indikation für die Synovialektomie.
Welche Effekte hat sie?
Rüther: Der Eingriff verringert die Schwellung und die Schmerzen sowie das gelenkzerstörerische Potenzial der Entzündung. Wenn ein Gelenk möglichst radikal synovialektomiert wird, bildet sich binnen sechs Wochen eine neue Synovialis - ansonsten wäre das Gelenkgleiten ja nicht mehr möglich.
Es besteht von Gelenk zu Gelenk unterschiedlich und in Abhängigkeit von der Radikalität der Operation eine gewisse Gefahr, dass sich die neue Gelenkinnenhaut wieder entzündlich-rheumatisch verändert, meist erst nach vielen Jahren. Das muss mit den Patienten besprochen werden.
Kann man den Eingriff am selben Gelenk wiederholen?
Rüther: Unbedingt! Die Synovialektomien können heute überwiegend endoskopisch vorgenommen werden. Damit gibt es keine großen Hautschnitte mehr, die Operation ist insgesamt schneller und schonender geworden.
Wo steht man im Moment beim Ersatz mittelgroßer und kleiner Gelenke?
Rüther: Am Sprunggelenk sind in den vergangenen Jahren tatsächlich wesentliche Fortschritte gemacht worden, die versteifende Operation am oberen Sprunggelenk ist nicht mehr der Goldstandard. Das operative Können an diesem Gelenk hat deutlich zugenommen, die Materialien sind besser, die Konstruktionen zuverlässiger geworden.
Damit ist die Endoprothese am oberen Sprunggelenk inzwischen eine ernst zu nehmende Option. Problematisch ist nach wie vor die Wechseloperation nach Lockerung. Deshalb wird bei 30- bis 40-jährigen Patienten nach wie vor eher die Arthrodese empfohlen und bei Patienten über 60 eher die Prothese.
Wie sieht es am Ellenbogen aus?
Rüther: Dort wird in Deutschland selten operiert, keine 400 Ellenbogenprothesen sind es im Jahr. Deshalb muss man beim Betrachten der Ergebnisse vorsichtig sein.
In der Hand des Erfahrenen sind die zur Verfügung stehenden Implantate eine brilliante Option mit hervorragenden Ergebnissen; und es gibt Austauschmöglichkeiten bei Versagen der Prothese. Und wir sollten daran denken, dass es am Ellenbogen aus funktionellen Gründen keine Option zur Versteifung gibt.
Und was sagen Sie zu den kleinen Gelenken?
Rüther: An den kleinen Gelenken der Hand ist der Fortschritt in den vergangenen 30 Jahren gering. Viele Operateure sind aus gutem Grund zu den Silikonprothesen zurückgekehrt, die man schon vor 25 Jahren implantiert hat. Auch an den Zehengelenken sehen wir keinen großen Fortschritt.
Dort benötigen wir allerdings auch kaum Endoprothesen, weil gut funktionierende alternative chirurgischen Verfahren zur Verfügung stehen.
Wo sollten sich Patienten mit entzündlich-rheumatischen Gelenkkrankheiten operieren lassen?
Rüther: Sie sprechen etwas an, was uns orthopädischen Rheumatologen in der Tat auf der Seele liegt. Die Spezialisten, die diese besondere Art der Chirurgie beherrschen, geben sich nach außen nur schwer zu erkennen. Die DGORh bringt jetzt eine Zertifizierung als Spezialzentrum für operative Rheumatologie auf den Weg.
Ich empfehle darauf zu achten, dass der behandelnde Arzt im Krankenhaus die Zusatzbezeichnung "Orthopädische Rheumatologie" führt. Es sollte einen internistischen Rheumatologen am Krankenhaus geben. Vor allem wenn der Patient an mehreren Gelenken Probleme hat und wenn er auf Biologika eingestellt ist, sollte er sich an ein rheumachirurgisches Spezialzentrum wenden.
Viele Patienten fragen primär ihren Hausarzt...
Rüther: Mein Tipp: Suchen Sie auf der Homepage der DGORh (www.rheuma-orthopaedie.de) unter "Patienteninformationen" die Landkarte auf, dort sind die entsprechenden Zentren eingezeichnet. Auch diese sind übrigens subspezialisiert, was auf den jeweiligen Internetseiten nachzulesen ist.
Ein Qualitätsmerkmal ist zudem, wenn es an dem Zentrum eine Partnerschaft von internistischen und orthopädischen Rheumatologen gibt. Ansonsten wünsche ich mir von meinen primärärztlichen Kollegen: Denken Sie bei Patienten mit geschwollenen Gelenken an die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und sorgen Sie dafür, dass diese zügig in fachkundige Hände kommen, sei es der internistische oder der orthopädische Rheumatologe.