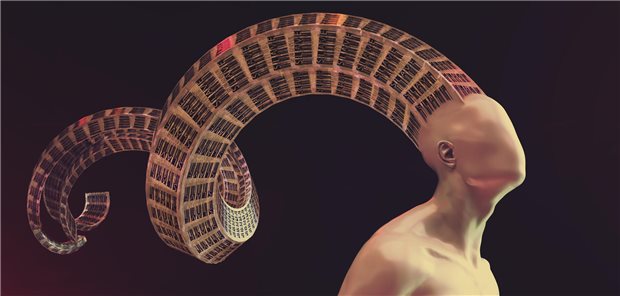Kiffer
Cannabis befeuert offenbar keine Depressionen und Co.
Wer gelegentlich Haschisch raucht, läuft offenbar Gefahr, weitere Süchte zu entwickeln - aber wohl keine psychischen Störungen. Das ist das Ergebnis einer US-Studie.
Veröffentlicht:
Ein gelegentlicher Joint treibt Kiffer weder in den Wahnsinn noch in die Depression. Verharmlosen sollte man Cannabis aber nicht.
© pink candy / fotolia.com
BETHESDA. Um den Cannabiskonsum ranken sich viele Mythen und Halbwahrheiten, daran haben auch Jahrzehnte medizinischer Forschung wenig geändert.
Mit der zunehmenden Legalisierung von Cannabisprodukten nicht zuletzt in den USA fragen sich viele Ärzte und Gesundheitsforscher, ob da nicht ein weiteres gewaltiges Drogenproblem die Gesundheit der Bevölkerung gefährden könnte. Dies ist nicht einfach zu beantworten, da es zu solchen Fragen nur wenige qualitativ hochwertige Studien gibt.
Als relativ gesichert gilt, dass Cannabis bei psychisch labilen Menschen Psychosen begünstigen kann. Zwar gibt es auch jede Menge Studien, die Zusammenhänge zwischen dem Konsum der pflanzlichen Droge und einer ganzen Reihe anderer psychischer Störungen herausgearbeitet haben.
Hierbei lässt sich jedoch kaum eruieren, ob die psychische Störung zum Kiffen verleitet oder umgekehrt das Kiffen krank macht.
Studie mit 43.000 US-Bürgern
Da Interventionsstudien praktisch nicht möglich sind, können höchstens prospektive, quasi-randomisierte Beobachtungsstudien in die Nähe einer kausalen Antwort gelangen Epidemiologen um Dr. Carlos Blanco vom National Institute on Drug Abuse in Bethesda haben nun versucht, mit einer solchen Untersuchung etwas mehr Klarheit zu schaffen (JAMA Psychiatry 2016; online 17. Februar).
Sie befragten für den Survey NESARC zunächst eine repräsentative Auswahl von 43.000 US-Bürgern über 18 Jahren nach ihrem Drogenkonsum und einer Reihe soziodemografischer Faktoren. Junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre) waren dabei leicht überrepräsentiert.
Drei Jahre später wurden die Befragten erneut interviewt. Zugleich fahndeten die beteiligten Ärzte mittels validierter Fragebögen nach Sucht- und Stimmungserkrankungen sowie Ängsten.
Insgesamt ließen sich Daten von 34.600 Teilnehmern auswerten (82 Prozent), die an beiden Befragungen teilgenommen hatten.
Bei den Interviews sollten sie angeben, ob sie in den zwölf Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert hatten, und falls ja, ob mehr oder weniger als einmal pro Monat.
Probleme in Kindheit und Jugend berücksichtigt
Was die Studie interessant macht, ist eine umfassende Analyse der Kindheit und Jugend. Die Teilnehmer sollten Suchtprobleme der Eltern, Scheidungen, Todesfälle in der Familie sowie Verhaltensauffälligkeiten in Kindheit und Jugend angeben.
Es wird vermutet, dass solche Probleme sowohl den Cannabiskonsum als auch psychische Erkrankungen begünstigen. Nach dem Selbstvertrauen und einer Reihe psychologischer Parameter wurde ebenfalls gefragt. Solche Angaben konnten anschließend als Begleitumstände in die Berechnungen einfließen.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag in der ersten Befragung bei 45 Jahren, die Hälfte war weiblich, 1279 hatten in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert (3,7 Prozent ). Solche Personen zeigten in Kindheit und Jugend sowie in der jüngeren Vergangenheit deutlich mehr Risikofaktoren für psychische Erkrankungen als Personen ohne Cannabiskonsum.
Entsprechend häufiger wurden bei ihnen auch psychische Störungen festgestellt. Berücksichtigten die Forscher jedoch alle Begleitfaktoren, so ergab sich vor allem eine erhöhte Rate von Suchterkrankungen, nicht jedoch von Depressionen, bipolaren Erkrankungen, Dysthymien oder Angst- und Panikstörungen.
Alkohol- und Suchterkrankungen wurden bei den Cannabiskonsumenten etwa doppelt so oft festgestellt wie bei Nicht-Kiffern.
Inzidenz für Ängste und Depressionen nicht erhöht
Drei Jahre später waren sowohl die Prävalenz als auch die Inzidenz von Suchterkrankungen bei den Cannabiskonsumenten der ersten Befragung weiter gestiegen. So traten neue Suchterkrankungen nun rund sechsfach häufiger auf als bei den Cannabisverächtern, wobei sich das Gros auf eine Cannabisabhängigkeit zurückführen ließ.
Aber auch die Inzidenz anderer stoffgebundener Süchte wie Alkohol- und Nikotinsucht war um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Dagegen zeigte sich nach Berücksichtigung sämtlicher Begleitfaktoren keine erhöhte Inzidenz für Ängste und Depressionen.
Lediglich bei sehr hohem Cannabiskonsum - etwa täglichen Joints - ergab sich ein Hinweis auf eine erhöhte Rate von psychischen Störungen jenseits des Suchtspektrums.
Die Studienautoren um Blanco validierten die Ergebnisse, indem sie neben einer multiplen Regressionsanalyse auf ein weiteres statistisches Verfahren setzten: das Propensity-Score-Matching.
Dabei wurde jedem Cannabiskonsumenten aus der ersten Befragung ein nicht kiffender Teilnehmer mit vergleichbaren soziodemografischen Faktoren und Risikomerkmalen gegenübergestellt.
Hierbei ergab sich ein fast identisches Bild: Nur Suchterkrankungen, nicht jedoch andere psychische Störungen waren bei den Cannabiskonsumenten in der zweiten Befragung signifikant häufiger zu beobachten - mit einer Ausnahme: So traten soziale Phobien bei den Kiffern dosisabhängig etwas häufiger auf, das Signifikanzniveau war jedoch grenzwertig.
Studienautoren gegen Legalisierung
Auch wenn ein gelegentlicher Joint den Kiffer weder in den Wahnsinn noch in die Depression treibt, so sind die Studienautoren um Blanco von den Legalisierungsbestrebungen zu Cannabis wenig begeistert.
Diese könnten dazu führen, die Risiken des Konsums zu unterschätzen. Zudem seien ein Anstieg von Suchterkrankungen sowie eine substanzielle gesellschaftliche Belastung zu befürchten.
Die Autoren hatten allerdings nicht nach Psychosen geschaut. Inzwischen gibt es aus einer anderen aktuellen Arbeit Hinweise, wie sich das erhöhte Psychoserisiko unter Cannabis erklären lässt (Transl Psychiatry 2016; online 16. Februar).
So konnten Forscher mit dem Cannabiswirkstoff THC psychotisches Verhalten bei gesunden Probanden auslösen, die über eine bestimmte Variante im AKT1-Gen verfügen.
Das Gen kodiert für eine Serin/Threonin-Protein-Kinase, die an der striatalen Dopaminrezeptor-Signalkaskade beteiligt ist. Diese Kinase wird durch THC bei einem Teil der Kiffer offenbar übermäßig aktiviert.