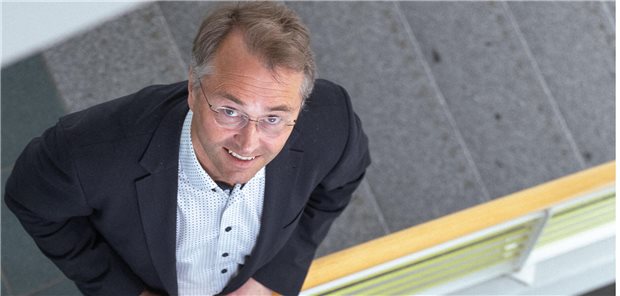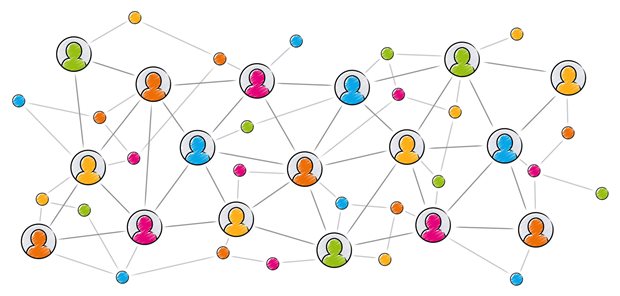Interview
Der Stärkere wird siegen - das sollte uns Sorgen machen
Ziemlich nüchtern fällt die Ein-Jahres-Bilanz für Birgit Fischer als Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller aus. Die Kritik der ehemaligen SPD-Gesundheitsministerin: Kurzfristiges, konfrontatives Denken, zu wenig Kooperation.
Veröffentlicht:
Im Gespräch mit vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer: Wolfgang van den Bergh (r.) und Helmut Laschet.
© Stephanie Pilick
Ärzte Zeitung: Frau Fischer, Sie haben vor einem Jahr die Hauptgeschäftsführung des vfa übernommen und angekündigt, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu allen Beteiligten im Gesundheitswesen aufschlagen zu wollen. Wie haben Ihre ehemaligen Kollegen von den Krankenkassen darauf reagiert?
Fischer: Zunächst gab es Irritationen. Im Lauf des Jahres hat sich gezeigt: Es geht nicht ohne Kooperation. Daran mangelt es aber in unserem Gesundheitswesen, das nach Sektoren aufgeteilt ist.
Es gibt vielfältige Vorbehalte gegeneinander. Aber ich muss sagen: Gegenüber der forschenden Pharma-Industrie gibt es noch am ehesten Offenheit, weil die Entwicklung neuer Medikamente unsere Kernkompetenz ist, die man für medizinischen Fortschritt braucht.
Ärzte Zeitung: Aktuell sieht es aber nach Konfrontation aus. Stichwort Vertraulichkeit des Erstattungsbetrages nach der Nutzenbewertung. Diese Vertraulichkeit lehnt die GKV ab, die Ärzte verstehen es nicht.
Fischer: Der GKV-Spitzenverband bemüht alles, um allein die Preise zu senken. Damit kauft man sich Probleme ein, die überflüssig sind und die sich mittelfristig absolut negativ für Deutschland auswirken werden.
Ärzte Zeitung: In welcher Weise?
Fischer: Behandelt man das Ergebnis von Verhandlungen zwischen GKV und Herstellern in Deutschland nicht vertraulich, dann wird dieses Ergebnis von anderen Ländern genutzt, um dieses zu unterbieten. Das würde dann auf Deutschland wieder zurückschlagen, weil 15 europäische Länder als Referenz genommen werden.
Ärzte Zeitung: Aus der Union haben Sie für Ihren Standpunkt Unterstützung erhalten, die FDP hält sich sehr bedeckt, die Opposition ist dagegen.
Birgit Fischer
Aktuelle Position: Seit dem 1. Mai 2011 Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller, Berlin.
Ausbildung: Studium der Erziehungswissenschaften an der Uni Münster 1972 bis 1977, Diplom-Pädagogin.
Karriere: 1977 bis 1980 pädagogische Leiterin des Evangelischen Bildungswerkes Frankenforum, 1980 bis 1986 Fachbereichsleiterin der Volkshochschule Lennetal; 1986 bis 1990 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bochum; seit 1981 SPD-Mitglied; seit 1990 mit kurzer Unterbrechung Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen, von 1998 bis 2005 Gesundheitsministerin; danach bis September 2006 Fraktionsvize; Anfang 2007 Wechsel zur Barmer Ersatzkasse, Anfang 2010 Vorstandsvorsitzende.
Ehrenamtliches Engagement: 2005 bis 2011 Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentages.
Fischer: Vertraulichkeit wäre nie ein Problem gewesen, wenn es nicht einen neuen Abrechnungsweg geben müsste, weil jetzt die PKV einbezogen ist. Wir haben aber jetzt eine Lösung mit dem Abrechnungssystem Zesar für die PKV. Viele Verhandlungsergebnisse in der Wirtschaft sind nur zu erzielen, weil sie vertraulich bleiben.
Irritationen sind jetzt durch Falschinformationen entstanden, dass nämlich neue Kosten entstehen würden, und zwar durch die Handelsspannen der Apotheken und des Großhandels.
Dabei war klar, und das hat der GKV-Spitzenverband unterschrieben, dass die prozentualen Margen des Handels nach wie vor auf dem Hundert-Prozent-Listenpreis der rabattierten Arzneimittel bestehen bleiben.
Ärzte Zeitung: Sie behaupten: Wir leben mit einem lernenden System. Aber: Werden denn die Schlussfolgerungen aus dem gezogen, was man gelernt hat?
Fischer: Nein. Wir haben eine politische Kultur, die nicht auf Kooperation und Verhandeln ausgelegt ist, sondern ein Kampf des Stärkeren. Wir sind aber im Gesundheitswesen darauf angewiesen, Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten leben können.
Konkret: Wir haben nach der frühen Nutzenbewertung nunmehr vier Opt-Out-Entscheidungen.Das heißt: Vier neue Medikamente haben die deutsche Medizin verlassen oder sind gar nicht eingeführt worden.
Deutschland verlässt den Kreis der Länder, die ihren Patienten und deren Ärzten medizinische Möglichkeiten so früh wie möglich zugänglich macht.
Hier zeichnet sich ein bestimmtes Muster ab: Die Wahl der vom G-BA ausgesuchten Vergleichstherapien macht es aus formalen oder inhaltlichen Gründen unmöglich, den Zusatznutzen der neuen Präparate überhaupt zu sehen.
Vergeblich haben die Firmen versucht, den G-BA von medizinisch sinnvolleren Vergleichstherapien zu überzeugen. Dieses Versagen ist charakteristisch für die deutsche Praxis - und darüber sollten sich alle Stakeholder Sorgen machen.
Ärzte Zeitung: Seit zwei fast Jahrzehnten ist das Verhältnis zwischen Ärzteschaft und Pharma-Industrie frostig. Sehen Sie Anzeichen für Tauwetter?
Fischer: Es gibt gegenseitige Annäherungsversuche. Die Regress-Situation belastet die Ärzte und schafft sie Verunsicherung. Das beeinträchtigt die Therapiefreiheit.
Damit ist die Sicht auf die Pharma-Industrie kritisch geworden, was den Blick auf den Beitrag der Industrie zum medizinischen Fortschritt trübt. Natürlich sehen die Ärzte auch den Finanzdruck, der auf dem System lastet.
Ärzte Zeitung: In diesem Zusammenhang setzen Ärzte die Hoffnung auf die Nutzenbewertung, dass sie dadurch aus dem Korsett ökonomischer Vorgaben befreit werden.
Fischer: Unsere Unternehmen sehen es so, dass eine funktionierende Nutzenbewertung ein neutraler Maßstab sein kann, der geeignet ist, alte Konflikte auszuräumen.
Ärzte Zeitung: Mit der möglichen Einbindung der Arzneimittelhersteller in die Integrationsversorgung hat der Gesetzgeber eine Grundlage für Kooperationen geschaffen. Aber die Ärzte sehen das meist kritisch. Wie erklären Sie sich das?
Fischer: Wenn die Therapie und die Therapiefreiheit durch die Dominanz ökonomischer Aspekte belastet wird, dann entsteht Konfrontation. Das muss überwunden werden, wobei die Nutzenbewertung und in diesem Zusammenhang die Versorgungsforschung eine wichtige Rolle spielen können.
Das ist aber eine mühsame Arbeit, die Zeit braucht. Aber Integrationsverträge könnten eine gute praktische Basis dafür sein, Vertrauen zurückzugewinnen.
Ärzte Zeitung: Wie kann man einen Mehrwert von Integrationsversorgung erklären?
Fischer: Der Mangel, den wir in unserem System haben, ist doch, dass wir zu wenig Abstimmung und Koordination haben. Und dass wir oft nicht die richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Therapie erreichen.
Bei der Diskussion mit Ärzten zeigt sich, dass die Notwendigkeit für Investitionen zunehmend anerkannt wird. Hier müssen wir ansetzen.
Ärzte Zeitung: Sie brauchen natürlich auch Kassen für solche Projekte. Wie groß ist deren Feedback?
Fischer: Das Finanzierungssystem der Krankenkassen mit einem gesetzlich fixierten Beitragssatz und Zusatzbeiträgen nur für Versicherte ist ein absolutes Handicap für die Kassen, in Projekte zu investieren, die zunächst zusätzliche Kosten verursachen. Deshalb ist die Forderung richtig, dass die Kassen eine Art Innovationsbudget haben müssen.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Player auch vom jeweils anderen und seinen Arbeitsbedingungen etwas verstehen - wir von den Ärzten und den Kassen, vice versa. Wir müssen mehr voneinander und übereinander wissen.
Ärzte Zeitung: Was kann der Beitrag sein, den ein forschendes Unternehmen leistet?
Fischer: Das ist einmal ihre Fähigkeit, langfristig zu denken. Da spielt die Versorgungsforschung eine wichtige Rolle: für die Qualitätssicherung und für den Erkenntnisgewinn. Denn eine Zusammenarbeit kann nicht auf blindem Vertrauen beruhen, sondern nur, wenn vereinbarte Ziele nachweislich erreicht werden.
Außerdem: Die Versorgungsforschung ist ein wichtiges Pendent zur frühen Nutzenbewertung. Denn in Wirklichkeit muss die frühe Nutzenbewertung als Nutzenprognose verstanden werden, die mit Forschung aus der realen Versorgungswelt erhärtet werden muss.
Ärzte Zeitung: Besonderen Wert legen Sie auf enge Zusammenarbeit mit Patienten-Selbsthilfegruppen, beispielsweise in Patientenforen. In welcher Weise hilft das Patienten?
Fischer: Patienten als unmittelbar Betroffene brauchen Information und Transparenz, damit sie selbstbestimmt eine Meinung entwickeln können. Oder, wenn es um die Nutzenbewertung geht, dann kann man nicht den Nutzen bewerten, ohne die Patienten zu fragen.
Jeder Arzt wird bestätigen, dass Patienten sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich auf Therapien reagieren. Die Probleme werden in einer alternden Gesellschaft durch mehr Multimorbidität komplexer.
Ärzte Zeitung: Themenwechsel - die personalisierte Medizin gilt einerseits als eine der großen Hoffnungen. Andererseits folgt aus der Stratifizierung, dass künftig auch Patienten von einer Therapie definitiv ausgeschlossen werden können. Das bringt Ärzte in Konflikte.
Fischer: Das glaube ich nicht: Was machen Ärzte heute? Es ist mitunter mühsam, einen Patienten auf das richtige Arzneimittel einzustellen.
Wenn es nun vorgeschaltet Diagnoseinstrumente gibt, die die Unwirksamkeit eines Arzneimittels oder starke Nebenwirkungen prognostizieren, dann ist das zum Nutzen von Patienten. Ich glaube, dass die Patienten froh darüber sind, wenn es zielgerichtete Behandlungen gibt.
Ärzte Zeitung: Die Kehrseite ist aber, dass Ärzte ihren Patienten mit größerer Gewissheit sagen müssen: Es gibt für Sie keinen Strohhalm mehr.
Fischer: : Ich weiß nicht. An diese Grenzen stoßen Ärzte mit ihren Möglichkeiten heute auch.
Ärzte Zeitung: Wird es die stratifizierte Medizin bei der frühen Nutzenbewertung leichter haben?.
Fischer: Die Personalisierte Medizin, bei der Diagnostik und Therapie auf eine Weise verknüpft ist, wirft für die frühe Nutzenbewertung noch einmal ganz neue methodische Fragen auf.
Wir erleben ja schon aktuell, welche methodischen Probleme wir haben, auch weil Methoden schematisch angewendet werden - aus Angst vor Präzedenzfällen. Das führt dazu, dass Innovationen in ihrer Differenziertheit nicht richtig bewertet werden und zum Teil große Probleme haben, auf den deutschen Markt zu kommen.
Es mangelt an Offenheit. Die frühe Nutzenbewertung ist eine Prognose, aber kein abschließendes Urteil. Meine Sorge ist, dass es eine Art schleichende Rationierung gibt, wenn der starre Kurs fortgesetzt wird.
Ärzte Zeitung: Was ist dann mit dem lernenden System?
Fischer: Nach meinem Eindruck wird dieser Begriff häufig als Ausrede benutzt, um zu sagen: Na ja, wir stehen am Anfang, es kann ja noch nicht alles rund laufen. Und sagt dann: Wir warten mal ab.
Ich verstehe lernendes System als einen Aufruf zum Handeln und zur Korrektur. Es mangelt an Bereitschaft und Dynamik, korrigierende Entscheidungen bei Fehlentwicklungen zu treffen.
Wir setzen damit Entwicklungen in Gang, die nicht rückholbar sind. Das ist ein hohes Risiko. NICE hat fünf Jahre gebraucht, um die Nutzenbewertung einzuführen - mit sehr genauer Reflektion. Bei uns war das ein Schnellschuss.
Dabei hat man nicht gelernt, mit Grauzonen und Unsicherheiten umzugehen. Das gehört aber bei Innovationen dazu.
Ärzte Zeitung: Wen sehen Sie da in der Pflicht?
Fischer: Alle Beteiligten: Gesetzgeber, Bundesausschuss, Krankenkassen. Wir brauchen aber auch die wissenschaftliche Beobachtung. Dabei muss auch kritisch bewertet werden, inwieweit die Entscheidungen des Bundesausschusses und des ihm unterstehenden IQWiG interessengeleitet sind.
Ärzte Zeitung: Das zeigt sich an der Präferenz möglichst alte generische Therapien als Vergleichsmaßstab zu wählen.
Fischer: Damit sollen Preisverhandlungen vorgeprägt werden. Das Zweite ist, dass Subgruppen gebildet werden, so dass die Datenlage bei kleinen Gruppen statistisch nicht mehr aussagefähig ist.
Ferner führen potenzielle Nebenwirkungen zu einer Schmälerung des Zusatznutzens. Das kann man aber nicht einfach saldieren.