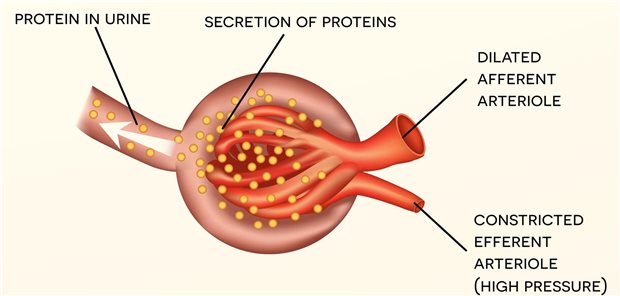Klinikqualität
"Rankinglisten wünsche ich mir nicht"
Der Druck auf die Kliniken wächst. Die Qualität der Leistungen soll vergleichbarer werden. Im Interview mit der "Ärzte Zeitung" erklärt Dr. Regina Klakow-Franck vom Gemeinsamen Bundesausschuss, wie das aussehen könnte - und was auf niedergelassene Ärzte bei der Qualitätssicherung zukommt.
Veröffentlicht:Dr. Regina Klakow-Franck

© BÄK
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, zuvor Studium der Medizin, germanistik, Philosophie und Anglistik
Unparteiisches Mitglied im GBA seit Juli 2012
Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Bundesärztekammer von 2005 bis Mitte 2012
Ärzte Zeitung: Wann wird es Rankings von Krankenhäusern und Arztpraxen geben?
Klakow-Franck: Ich wünsche mir eigentlich, dass es keine Rankinglisten geben wird, auf jeden Fall keine Hitlisten wie in bestimmten Nachrichtenmagazinen. Rankinglisten sind manipulationsanfällig und können Fehlanreize schaffen. Ein vorderer Platz in einer Hitliste ist nur ein Surrogat für gute Qualität.
Ich verstehe nicht, warum dem mehr getraut werden soll als Krankenhaus-Zertifikaten. Im Finanzierungs- und Qualitätsgesetz ist aber nicht von Rankings, sondern von Vergleichslisten die Rede. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied.
Ein solches Portal sollte methodisch wohl überlegt sein und die ganze Palette abbilden: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.
Wir brauchen ein gutes Zusammenspiel zwischen dem GBA, der die Richtlinien für die verpflichtend zu dokumentierenden Leistungsbereiche erstellt, und dem neuen Qualitätsinstitut, das dann daraus ein Bewertungsportal aufbaut - erst einmal für Krankenhäuser, perspektivisch auch für Arztpraxen.
Ärzte Zeitung:
Besteht nicht die Gefahr, dass das Portal für Laien unverständlich ist?
Klakow-Franck: Die vielen fachlichen Einzelinformationen zu einem Summenparameter oder Qualitätsindex zu aggregieren, ohne dabei den Informationsgehalt zu verkürzen oder zu verfälschen, das ist die hohe Kunst.
Derzeit müssen sich die Nutzer durch eine ganze Liste mit Indikatoren klicken, um sich ein Bild davon machen zu können, ob ein Krankenhaus Diagnostik und Therapie entsprechend einer evidenzbasierten Leitlinie anbietet. Fraglich ist, ob Patienten diese Fachinformationen verstehen können.
Wünschenswert wäre eine laienverständliche, kurze Darstellung hierzu. Den Probebetrieb des erwarteten neuen Bewertungsportals sehe ich frühestens 2017.
Wie ist denn der Stand beim Institut?
Klakow-Franck: Die Berliner Aufsichtsbehörde hat die Stiftungssatzung genehmigt. Die Institutsleitung soll noch in diesem Jahr besetzt werden. Dann haben wir noch ein ganzes Jahr, damit die Institutsleitung die volle Arbeitsfähigkeit herstellen kann, bevor am 31. Dezember 2015 der Vertrag mit dem AQUA-Institut ausläuft.
Wird es im kommenden Jahr, möglicherweise auch danach, zwei Institute geben, die für den GBA arbeiten? Oder löst das neue Institut das bisherige Institut AQUA schlagartig ab?
Klakow-Franck: 2015 wird ein Jahr der Überlappung. Das neue Institut wird dann noch keine neuen Aufträge bekommen, sondern sich auf die Übernahme der laufenden Aufgaben konzentrieren müssen.
Ein Beispiel: Damit die Bundesauswertung der externen stationären Qualitätssicherung im Sommer 2016 freigegeben werden kann, müssen die Daten dafür spätestens am 28. Februar 2016 vom neuen Institut angenommen werden können - besser noch wäre zum Jahresende 2015.
Wieviel AQUA wird im neuen Qualitätsinstitut drinstecken?
Klakow-Franck: Ich will mich nicht dazu äußern, welche Gesichter man weiterhin sehen wird, schließlich ist das Bewerbungsverfahren für die Institutsleitung noch nicht abgeschlossen. Tatsache ist, wir brauchen ein Institut, das solche Strukturen wie derzeit AQUA vorhält, um die unterschiedlichen Funktionen stemmen zu können.
Als da sind: Datenmanagement und -auswertung, konkrete Durchführung von QS-Verfahren wie zum Beispiel in der Transplantationsmedizin und die wissenschaftlich fundierte Neuentwicklung von Verfahren unter gesetzlich vorgegebener Einbeziehung eines großen Kreises von zu Beteiligenden.
Das neue Institut soll sich auch um die Qualitätssicherung im ambulanten Bereich kümmern, die KVen sind da auch aktiv. Braucht man eine externe Qualitätssicherung für den ambulanten Sektor?
Klakow-Franck: Die KVen machen schon in großem Umfang Stichproben-Prüfungen. Das ist viel zu wenig bekannt. Es gibt die politische Erwartung, die ambulante Qualitätssicherung hochzufahren. Das werden wir mit dem neuen Institut in Angriff nehmen.
Ich möchte aber dafür sensibilisieren, dass die Vorgehensweise aus der stationären Qualitätssicherung nicht eins zu eins auf die Vertragsärzte übertragen werden kann. Dort gibt es viel geringere Fallzahlen und die chronischen Erkrankungen stehen im Vordergrund.
Dafür muss man Langzeitverläufe im Blick behalten und meist sind mehrere Behandler beteiligt. Es steht dann schnell die Frage im Raum, wem ein Qualitätsdefizit zugeschrieben werden soll.
Wie wollen Sie das lösen?
Klakow-Franck: In den DMP und bei der Dialyse kommen bereits Qualitätsindikatoren zum Einsatz. Ich rate dazu, nicht nur Ergebnisqualität messen zu wollen, denn das ist in der ambulanten Versorgung nicht weniger anspruchsvoll als in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung.
Ich hielte es für sinnvoll, zunächst die Struktur- und Prozessqualität in den Blick zu nehmen und mit Qualitätsindikatoren zu messen, wie dies in den Praxen implementiert ist, beispielsweise was die Umsetzung einer rationalen Antibiotikatherapie anbelangt.
Stichwort sektorenübergreifende Qualitätssicherung: Der GBA hat einige der bisherigen Modellversuche zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung abgebrochen wegen nicht zu überwindender Schnittstellenprobleme. Vor diesem Problem steht das neue Institut doch auch…
Klakow-Franck: Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung ist und bleibt unverzichtbar. Die Barrieren bei der Umsetzung sind am Anfang unterschätzt worden. Hieraus haben wir bereits Konsequenzen gezogen.
Solange für Vertragsärzte und Krankenhäuser sektoral völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen gelten und insbesondere unterschiedlich kodiert wird, werden wir bevorzugt auf die Nutzung der Sozialdaten der Krankenkassen setzen.
Alle Verfahren, die AQUA derzeit für uns entwickelt, basieren auf Sozialdaten plus flankierenden Patientenbefragungen. An diese bereits erfolgten Weichenstellungen kann das neue Institut nahtlos anknüpfen.
Wir haben auch den Vorschlag gemacht, einen QS-Marker auf der elektronischen Gesundheitskarte aufzubringen, um die Fälle leichter identifizieren und verfolgen zu können. Hier wage ich aber keine Prognose, wann das jemals aufgegriffen wird.
Wann ist denn mit konkreten Ergebnissen in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zu rechnen?
Klakow-Franck:Das erste Verfahren wird die sektorenübergreifende Qualitätssicherung der perkutanen Koronarintervention sein. Hierzu haben wir das Stellungnahmeverfahren eingeleitet. Ich hoffe, dass ab 2016 der Regelbetrieb läuft.
Der Entwurf des Versorgungsstärkungsgesetzes sieht vor, dass der GBA mengenanfällige Leistungen für Zweitmeinungen ermitteln soll. Wie wollen Sie die Leistungen ermitteln?
Klakow-Franck: Es sind gar nicht einmal die Diagnosen, die klassischerweise im Verdacht stehen, mengenanfällig zu sein, so wie Knie- und Hüft-TEP. Da haben sich die Zahlen stabilisiert. Das Gutachten von Schreyögg und Busse hat herausgearbeitet, dass mengenanfällig bevorzugt die Leistungen zu sein scheinen, die erstens planbar sind und für die zweitens ökonomische Fehlanreize bestehen.
Das Gutachten nennt als Beispiel die Spondylose, bei der der operative Eingriff, sei er auch minimalinvasiv, deutlich höher vergütet wird als das konservative Vorgehen. Solche Fehlanreize bekommt man auch durch ein Zweitmeinungsverfahren nicht in den Griff.
Zielführender wäre es an dieser Stelle, die DRG weiter zu entwickeln. Die Aufklärung über eine Therapiealternative sollte schon Bestandteil der Erstmeinung sein, alles andere wäre nicht nur nicht medizinisch sachgerecht, sondern auch unwirtschaftlich.
Aus meiner Sicht sind Zweitmeinungsverfahren dann sinnvoll, wenn es sich um schwierige Einzelfallentscheidungen handelt oder um Leistungen, für die der Arzt eine ganz besondere Qualifikation braucht.
Das könnte zum Beispiel die Frage sein, ob ein Fuß bei fortgeschrittenem Diabetischen Fußsyndrom amputiert werden muss oder nicht. Hierzu gibt es auch schon Modellprojekte, die zeigen, dass systematische Zweitmeinungsverfahren bei dieser Indikation sinnvoll sind.
Der GBA soll ja auch planbare Leistungen definieren, für Qualitätsverträge zwischen Kassen und Krankenhäusern. Gibt es dazu schon Vorstellungen?
Klakow-Franck: In unseren Gremien ist darüber noch nicht beraten worden. Ich könnte mir dazu Qualitätsverträge als Alternative zu Mindestmengenregelungen vorstellen. Dann würde dies planbare und komplexe Leistungen betreffen, die besonders hohe Struktur- und Prozessqualitätsvoraussetzungen verlangen.
Es würde mich wundern, wenn in diesem Zusammenhang Knie- und Hüft-TEP nicht diskutiert werden sollten. Oder man nutzt Qualitätsverträge zum Beispiel dafür, die Indikationsqualität zu fördern.
Vielleicht trägt dies dazu bei, große regionale Unterschiede bei der Häufigkeit von Operationen zu reduzieren, wie etwa bei der Tonsillektomie oder der Hysterektomie.
Im Koalitionsvertrag steht, Qualität solle zur Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung gestärkt werden. Ist denn Qualität heute als Voraussetzung für die Teilnahme an der ASV zu niedrig angesetzt?
Klakow-Franck: Im Koalitionsvertrag liest es sich so, als solle der Nachweis guter Qualität zur Voraussetzung gemacht werden, um an der ASV teilnehmen zu können. Wenn hiermit der Nachweis guter Ergebnisqualität auf Basis von Qualitätsindikatoren gemeint ist, ist der Vorschlag nicht praktikabel.
Die ASV ist zwar prädestiniert für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Aber diese läuft ja erst an und die ASV-Teams starten ebenfalls jetzt erst.Oder die Passage ist so gemeint, dass schärfer überprüft werden müsse, ob die personellen und sächlichen Mindestanforderungen erfüllt werden.
Es ist Aufgabe der Erweiterten Landesausschüsse zu überprüfen, ob unsere Vorgaben erfüllt werden. Die einen prüfen sehr kleinteilig, die anderen unbürokratischer. Es gibt derzeit noch große regionale Unterschiede.
Insbesondere aus diesem Grund hatten wir die Erweiterten Landesausschüsse bereits im Sommer in den G-BA eingeladen und wir werden den Dialog im nächsten Jahr fortsetzen, um eine Harmonisierung des Anzeigeverfahrens zu fördern.
Ist daran gedacht, die ASV zur Vorreiterin einer sektorenübergreifenden elektronischen Dokumentation zu machen?
Klakow-Franck: Papiergestützte Dokumentation ist keine Alternative mehr. Es hätte aber keinen Sinn ergeben, jetzt in die Vorgaben für die Teilnahme an der ASV hineinzuschreiben, die Dokumentation müsse elektronisch erfolgen, weil zunächst bessere Rahmenbedingungen für die Interoperabilität zwischen den PVS-Systemen und der Qualitätssicherung geschaffen werden müssen.
Wir haben als G-BA keinen Hebel, um die Interoperabilität durchzusetzen. Vielleicht bringt uns das von Gesundheitsminister Gröhe angekündigte E-Health-Gesetz etwas weiter.
Warum ist die Depression noch nicht DMP-fähig?
Klakow-Franck: Von den mehr als 30 neuen DMP-Themen, die beim GBA eingereicht wurden, haben wir Depression weit oben, nämlich an sechster Stelle, priorisiert. Derzeit wird die Psychotherapie-Richtlinie im GBA überarbeitet.
Dies ist ein wichtiger Grund, der dazu geführt hat, Depression nicht in diejenigen Diagnosen einzuschließen, die wir zu allererst angehen wollen.
Ein weiterer waren offene Fragen zur Eingrenzbarkeit der eigentlichen Zielgruppe für ein DMP Depression. Es gab Bedenken, ob die heutige Kodierung dies leisten kann.Zudem gibt es zwar viele IV-Verträge zur Behandlung depressiver Patienten, aber so gut wie keine Evaluationen beziehungsweise keine Veröffentlichungen hierüber.
Erkenntnisse über die Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit von bereits vorhandenen strukturierten Behandlungskonzepten sind jedoch ein wichtiges Entscheidungskriterium für den GBA.
Wird das DMP Rückenschmerz, das jetzt in Angriff genommen werden soll, noch konkreter definiert?
Klakow-Franck: Es wird für den chronischen Rückenschmerz definitiv eine Abschichtung erfolgen. Hier gilt: DMP ungezielt für alle, die Rückenschmerzen haben, würde keinen Sinn machen.
Wir müssen die Gruppe identifizieren, die von einem DMP auch wirklich profitieren kann.
Wer könnte das sein?
Klakow-Franck: Wünschenswert wäre aus meiner Sicht, dass Patienten mit rezidivierenden Rückenschmerzen nicht zu spät ein DMP angeboten bekommen, um die Chronifizierung des Leidens nach Möglichkeit zu vermeiden.
Das Interview führte Anno Fricke