Geschlechtsspezifische Medizin
Der kleine Unterschied ist größer als gedacht
Geschlechtsspezifische Besonderheiten sind eigentlich medizinischer Alltag. Die Gendermedizin versucht, diesen Besonderheiten auf den Grund zu gehen. Doch die Translation der Erkenntnisse in die tägliche Praxis ist noch ein Problem.
Veröffentlicht: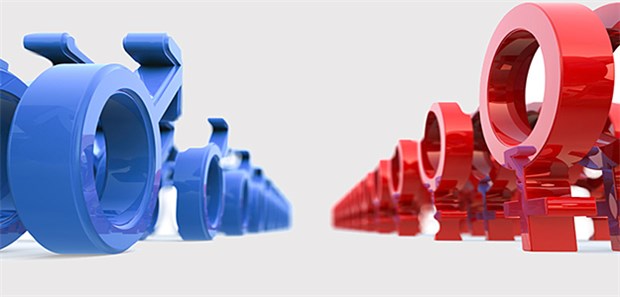
Männer und Frauen reagieren auf Umwelt und Krankheiten unterschiedlich – und dieser Unterschied verändert sich stetig.
© Raycat / Getty Images / iStock
In der Medizin wurde lange so getan, als könne diese mehr oder weniger geschlechterneutral praktiziert werden. XY versus XX – den chromosomalen Unterschied lässt man noch gelten, auch verschiedene Hormonprofile.
Dass deshalb Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen, dass psychosoziale Verhaltensmuster differieren, dass auf Einflüsse aus Umwelt und Umfeld geschlechtsspezifisch reagiert wird, in Wirklichkeit ist das doch uralte Alltagserfahrung!
Dass dennoch zum Teil auch heute noch erläutert werden muss, dass "Gendermedizin" keine feministische Ideologie ist, die im weißen Kittel daherkommt, hängt unter anderem vielleicht mit der Begrifflichkeit zusammen.
Gemeint ist eben "geschlechtsspezifische" Medizin, weshalb sich jene Fachorganisation, die sich in Deutschland um Gendermedizin kümmert, Deutsche Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin (DGesGM) genannt hat.
Geschlechtsspezifisch, das Wort schließt beide Komponenten der Gendermedizin ein: das biologische Geschlecht – Sex – und die soziokulturelle Dimension – Gender, ein Begriff aus den Sozialwissenschaften.
"Die deutsche Sprache ist in diesem Fall genauer als das Englische", sagt Professor Vera Regitz-Zagrosek, Präsidentin der DGesGM und Leiterin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin (GIM) an der Charité Berlin. Der Kürze halber wird international "Gender Medicine" als Überbegriff verwendet.
Aber ist Gendermedizin in Zeiten der personalisierten, der Präzisionsmedizin überhaupt noch zeitgemäß? Gendermedizin sei integrativer Bestandteil der personalisierten Medizin der Zukunft, erklärte vor einigen Jahren die Wiener Endokrinologin Professor Alexandra Kautzky-Willer, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Gendermedizin (IGM), in einem Beitrag für das Bundesgesundheitsblatt (Bundesgesundheitsbl 2014; 57:1022-30).
Männer bekommen häufiger Krebs
Selbst wenn bereits heute biologische Risikomarker, genetische Prädispositionen oder Lebensstilfaktoren die therapeutischen Entscheidungen mitbestimmen, werde das biologische und das soziale Geschlecht auch künftig als unabhängige Einflussgröße zu beachten sein, meint Kautzky-Willer.
Denn nicht nur genetische Varianten oder epigenetische Modifikationen seien mitunter geschlechtsabhängig. Es gebe eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Umweltfaktoren. Und die körperlichen und seelischen Reaktionsmuster auf Stress unterscheiden sich bei Männern und Frauen ebenfalls.
Hinzu kommt: Die Unterschiede von Krankheiten bei Männern und Frauen sind nichts Statisches. Biologie und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Verändert sich die Umwelt, dann verändern sich soziale Rollenmuster, resultieren Anpassungsvorgänge.
Mittel- und langfristig führen Änderungen der Lebensverhältnisse oder die Tatsache, dass zum Beispiel Frauen zunehmend in klassischen Männerberufen arbeiten oder in "Männersportarten" trainieren (Fußball, Gewichtheben) zu Angleichungen oder Diversifizierungen von Risiken und Krankheitsmustern – ein permanent dynamischer Prozess.
Beispiel Rauchen und Alkoholkonsum: Das im Vergleich höhere Krebsrisiko von Männern und deren kürzere Lebenserwartung werden unter anderem darauf zurückgeführt. Bekanntlich haben die Frauen in puncto Rauchen in den vergangenen Jahrzehnten aufgeholt. Frauen rauchen jedoch aus anderen Gründen als Männer, bevorzugt wegen Stress, psychischer Probleme oder zur Gewichtskontrolle.
Kautzky-Willer weist darauf hin, dass Frauen biologisch vulnerabler sind für Nikotin und die Rauchinhaltsstoffe, schwere COPD-Verläufe träten früher auf, bei im Vergleich geringerer kumulativer Rauchexposition.
Das Risiko für Herzinfarkte ist 25 Prozent höher als bei Männern. Ebenso ist das Risiko für Lungen- und Blasenkrebs höher, die Menopause tritt früher ein als bei Nichtraucherinnen.
Frauen verlieren ihre Zähne eher
"Man muss den Frauen sagen, dass Rauchen für sie noch gefährlicher ist als für Männer", erklärt Regitz-Zagrosek. "In Österreich rauchen bereits mehr Mädchen als Jungen", stellte Kautzky-Willer fest.
Und in vielen europäischen Ländern nehme die Alkoholabhängigkeit unter Frauen zu. Dass Medizin und Gesellschaft auf derartige geschlechtsspezifische Veränderungen reagieren müssen, liegt auf der Hand.
Genetische und/oder hormonelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen bedingen unterschiedliche Risiken für Osteoporose, für Herzkrankheiten, Nieren- und Leberfunktionsstörungen.
Die unterschiedliche Schmerzempfindlichkeit von Männern und Frauen hat etwas mit den Sexualhormonen zu tun, Gender-Stereotypien spielen dort mit hinein. Und aus jüngst veröffentlichten Tierexperimenten geht hervor, dass die Schmerzverarbeitung auf zellulärer Ebene ganz anders läuft.
Frauen sind in der Pubertät häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen als Männer, mit Ausnahme des Typ-1Diabetes: Ab der Adoleszenz sind Männer häufiger betroffen. Beim Asthma ist es umgekehrt: Bis zur Pubertät erkranken häufiger Jungen, danach sind es mehr Frauen.
Weitere Beispiele: Die unterschiedliche Körperfettverteilung bei Männern und Frauen hat Einfluss auf die Entstehung kardiometabolischer Erkrankungen. Männer mit Rektumkarzinom werden eher abdominoperineal operiert und sind vergleichsweise kränker, Frauen bekommen häufiger einen Anus praeter. Männer haben häufiger Parodontitis und Leukoplakien, Frauen haben mehr Kiefergelenkserkrankungen, mehr Karies und verlieren ihre Zähne eher.
Nachteile für beide Geschlechter
Die geschlechtsneutrale Medizin hat Nachteile für Frauen wie für Männer, denkt man etwa an die häufig verspätete Diagnostik von Herzerkrankungen bei Frauen. Dafür wird bei Männern seltener an Osteoporose gedacht, die wiederum als Frauenkrankheit gilt.
Frauen werden im Durchschnitt deutlich älter als Männer, obwohl sie mehr unter Komorbiditäten leiden und in Summe weniger gesunde Lebensjahre haben. Biologische Unterschiede sind dafür wahrscheinlich nur zu einem geringen Teil verantwortlich.
Regitz-Zagrosek verweist auf einen statistischen Effekt: "Männer haben im mittleren Lebensalter eine relativ hohe Sterblichkeit aufgrund von Risikoverhalten und Unfällen, die wir bei Frauen so nicht sehen." Und Kautzky-Willer zitiert bayrische Klosterstudien, wonach Nonnen und Mönche bei vergleichbaren Lebensbedingungen durchaus ähnlich alt geworden sind.
Nur ein bis zwei Jahre der längeren Lebenszeit von Frauen seien biologisch bedingt, vier bis fünf Jahre des Mortalitätsunterschiedes seien Lebensstil-, Umwelt- und psychosozialen Faktoren zuzuschreiben. Die Komponente "Gender" spielt für die Lebenserwartung also eine große Rolle.
Gender-Score entwickeln
Diese Komponente messbar zu machen, daran arbeiten Regitz-Zagrosek und ihre Kollegen derzeit. "Es ist nicht so, dass Männer auch soziokulturell immer rein männlich sind und Frauen soziokulturell immer rein weiblich", sagt die Wissenschaftlerin.
Ziel sei es, einen Gender-Score zu entwickeln, mit dem sich die soziokulturellen Eigenschaften von Frauen und Männern bestimmen lassen und auch Abstufungen erfasst werden können.
Ein solcher Score könnte künftig hilfreich für individuelle Risikoabschätzungen sein, etwa inwiefern nach durchgemachtem Herzinfarkt ein Re-Infarkt droht. Gegebenenfalls könnten entsprechende Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden.
Insgesamt scheint es derzeit aber noch schwer zu sein, aus den Erkenntnissen der gendermedizinischen Forschung unmittelbar praktische Handlungsempfehlungen für den medizinischen Versorgungsalltag abzuleiten. "Für mich als Medizinerin ist das eine ganz zentrale Frage", betont allerdings Regitz-Zagrosek.
Risikoprofile zu erstellen habe sich als sehr hilfreich erwiesen, denkt man an Stoffwechselstörungen und kardiologische Erkrankungen.
"Ich kann mir vorstellen, dass man so etwas auch für psychosoziale Profile machen kann." Und auch bei Medikamentenverordnungen und Dosierungen müsse das Geschlecht bedacht werden.
Lesen Sie dazu auch: Zwischen Mann und Frau: Viele geschlechtsspezifische Unterschiede bei Krebs Kardiologie: Viele Frauen unterschätzen ihr Herzinfarkt-Risiko Auch an Männer denken!: Osteoporose ist keine Frauenkranheit





