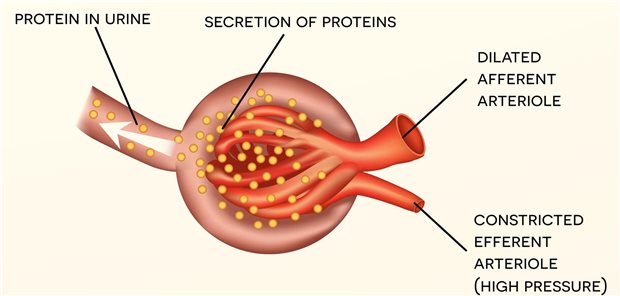Urteil zur Aufklärungspflicht
Zwei Sätze weisen die Richtung
Der Bundesgerichtshof hat kürzlich mit einem Leiturteil zur Aufklärungspflicht den Ärzten den Rücken gestärkt - der Fall stammt aber aus einer Zeit vor dem seit März 2013 geltenden Patientenrechtegesetz. Gilt der Spruch jetzt auch für die neue Rechtslage? Einiges spricht dafür.
Veröffentlicht:
Mit einer guten Dokumentation sind Ärzte vor Gericht immer gut gerüstet.
© Mediaphotos / iStockphoto
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer aktuellen Entscheidung bestätigt, dass den Angaben eines Arztes über eine erfolgte Risikoaufklärung zu glauben ist, wenn seine Darstellungen in sich schlüssig sind und "einiger" - so der BGH wörtlich - Beweis für den Inhalt eines mündlichen Aufklärungsgespräches erbracht ist.
Dies ist immer dann bedeutsam, wenn nicht alle Inhalte der Aufklärung schriftlich dokumentiert sind und sich auch der Arzt - völlig nachvollziehbar - nicht an jedes Detail der konkreten Aufklärung erinnert, aber überzeugend darlegen kann, dass er regelmäßig in einer bestimmten Weise aufklärt und auf Risiken hinweist.
Der BGH führt aus, dass an den dem Arzt obliegenden Beweis für die Inhalte der Aufklärung keine unbilligen oder übertriebenen Anforderungen gestellt werden dürfen.
Im Zweifel sollte dem Arzt geglaubt werden, dass auch im Einzelfall in der gebotenen Weise aufgeklärt wurde, da angesichts der Vielzahl von Informations- und Aufklärungsgesprächen, die Ärzte täglich führen, nicht erwartet werden kann, dass sich der Arzt genau an jedes einzelne Gespräch erinnert.
Wenn er jedoch schlüssig darlegt, dass er üblicherweise mündlich über ein bestimmtes Risiko aufklärt, auch wenn dies im schriftlichen Aufklärungsbogen nicht erwähnt wird, so darf - und sollte - jeder Richter dem Glauben schenken.
Der BGH betont nämlich auch, dass die Beweislastverteilung, wonach der Arzt den Inhalt des Aufklärungsgespräches beweisen muss, vom Patienten oder den Patientenanwälten "zu haftungsrechtlichen Zwecken missbraucht" werden könnte. Realitätsnäher kann man die tägliche Situation in der Praxis und auch in Haftpflichtprozessen nicht beschreiben.
Im Urteil Bezüge zum Patientenrechtegesetz
Dieses Urteil bezieht sich auf eine Behandlung im Jahr 2004. Es ist deshalb die Frage aufgeworfen worden, ob wegen des Patientenrechtegesetzes heute anderes gilt.
Auch die Richter des BGH könnten bei der Formulierung der Urteilsgründe diese Frage im Hinterkopf gehabt haben; aus zwei Sätzen in dem Urteil kann man nämlich durchaus Hinweise auf die aktuelle Rechtslage herauslesen:
Der BGH wiederholt zunächst seine seit Jahrzehnten geltende Rechtsprechung, wonach aus medizinischer Sicht eine Dokumentation der Aufklärung regelmäßig nicht erforderlich ist. Dies ist von Bedeutung, da Paragraf 630 f Abs. 2 BGB seit 2013 vorschreibt, dass der Arzt verpflichtet ist, in der Patientenakte auch Einwilligungen und Aufklärungen zu dokumentieren.
Diese neue gesetzliche Verpflichtung geht also über die bisherigen Anforderungen der Rechtsprechung hinaus. Es besteht allerdings allgemeiner Konsens, dass der Gesetzgeber mit dem Patientenrechtegesetz im Wesentlichen nur die bisherige Rechtsprechung kodifizieren wollte.
Der BGH kann nun einen eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht ignorieren; mit der Betonung, dass eine schriftliche Dokumentation der Aufklärung aus medizinischen Gründen nicht erforderlich ist, lenkt er das Augenmerk aber auf die Frage, was eigentlich die Rechtsfolge einer - entgegen dem neuen Recht - unterlassenen Dokumentationen der Aufklärung ist.
In dieselbe Richtung zielt der weitere Satz des BGH, wonach eine schriftliche Dokumentation des Aufklärungsgespräches "nützlich und dringend zu empfehlen" ist und jedenfalls in der stationären Behandlung "erwartet werden kann".
Es hätte sehr nahegelegen, die Begriffe "nützlich" und "empfehlenswert" dadurch zu untermauern, dass mit einem kurzen Halbsatz darauf hingewiesen wird, dass der Gesetzgeber inzwischen sogar die Dokumentationspflicht normiert hat. Dieser Halbsatz fehlt aber im BGH-Urteil.
Verstöße gegen die Dokumentationspflicht nach Paragraf 630 f Abs. 2 BGB führen nämlich zunächst nur dazu, dass der Patient einen Schadensersatzanspruch hat, wenn er eine nicht dokumentierte Behandlungsmaßnahme nochmals durchführen lassen muss.
Der Schaden umfasst die zusätzlichen Behandlungskosten. Ein solcher Schaden kann bei der unterlassenen Dokumentation einer erfolgten Aufklärung nicht eintreten.
Im Fokus steht die Frage der Beweislast
Die wesentliche Folge einer unterlassenen Dokumentation liegt daher in den Fragen der Beweislast. Die einzige Änderung der Beweislage könnte man nun inParagraf 630 h Abs. 3 BGB sehen.
Danach wird seit 2013 gesetzlich vermutet, dass eine bestimmte Handlung oder Feststellung nicht erfolgt ist, wenn "eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis" nicht schriftlich dokumentiert sind. Diese Regelung gilt aber eben nur für medizinisch gebotene Maßnahmen.
Wenn der BGH nun erneut betont, dass aus medizinischer Sicht eine Dokumentation der Aufklärung nicht erforderlich ist, so handelt es sich bei der Aufklärung eben auch nicht um eine medizinisch gebotene Maßnahme.
Diese Dokumentation ist allein rechtlich - nicht aber medizinisch - geboten, damit wird aber auch bei unterlassener Dokumentation nicht gesetzlich vermutet, dass keine Aufklärung erfolgte. Man kann das Urteil des BGH also durchaus so lesen, dass er sehr subtil auch die Rechte der Ärzte unter der neuen Rechtslage des Patientenrechtegesetzes gestärkt und bestätigt hat.
Unabhängig davon, dass man seit 2013 die Aufklärung schriftlich dokumentieren muss, steht dem Arzt auch weiterhin der Beweis einer mündlichen, eben nicht dokumentierten Aufklärung offen. Wenn der darlegt, regelmäßig über ein bestimmtes Risiko mündlich zu informieren, so ist ihm zu glauben. Bei aller Juristenschelte:
Mit diesem Urteil werden realitätsnahe Einschätzungen des ärztlichen Alltags und Gerechtigkeit vereint.
Dr. Ingo Pflugmacher ist Fachanwalt für Medizin- und Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Busse & Miessen in Bonn.