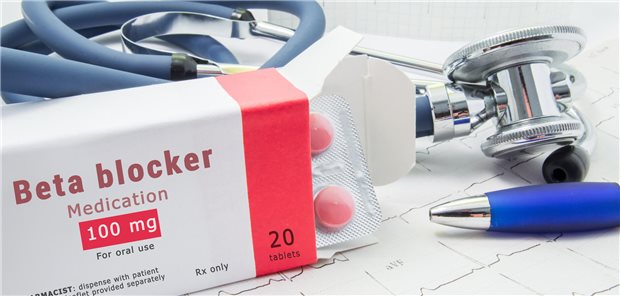Centrum für Reisemedizin
Vogelgrippe in China auf dem Höchststand
In China erreichen Fallzahlen von aviärer Influenza A (H7N9) einen Höchststand.
Veröffentlicht:DÜSSELDORF. Im Frühjahr 2013 sind in China erstmals Infektionen bei Menschen mit dem aviären Influenza A-Virus vom Subtyp H7N9 beobachtet worden. Bis Ende März 2017 wurden der WHO insgesamt mehr als 1300 Erkrankungsfälle aus China gemeldet, mindestens 489 von diesen Patienten sind gestorben, berichtet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Betroffen sind insbesondere die Provinzen Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian und Anhui im Osten des Landes. Es gab einzelne Importe aus China nach Kanada (2 Fälle) sowie Malaysia (1 Fall). Infektionen mit Influenza A (H7N9) treten in saisonalen Erkrankungswellen jeweils in den Wintermonaten auf. Die derzeitige fünfte Erkrankungswelle, die im Oktober 2016 begann, liegt mit 509 Fällen deutlich über den Zahlen der vorherigen Jahre.
Menschen infizieren sich fast ausschließlich über den Kontakt zu Geflügel oder eine z. B. durch Vogelexkremente kontaminierte Umgebung; eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde nur in Einzelfällen berichtet. Infizierte entwickeln Fieber, Kurzatmigkeit und eine Symptomatik der oberen Atemwege, viele leiden zudem unter (teils schweren) Lungenentzündungen. Die Letalitätsrate liegt regelmäßig zwischen 32 und 44 Prozent. Es sind jedoch auch milde Krankheitsverläufe bekannt. Bei Vögeln führt der Erreger zu keinen nennenswerten oder auch gar keinen Erkrankungserscheinungen.
Reisenden nach China wird geraten, den Kontakt zu Vögeln (auch wild lebenden) und deren Ausscheidungen zu vermeiden und zudem auf den Besuch von Geflügelmärkten oder Farmen zu verzichten. Nahrungsmittel sollten nur in ausreichend gegarter Form verzehrt werden. Auch auf regelmäßiges Händewaschen und sonstige adäquate Hygienemaßnahmen sollte geachtet werden. Ein Impfstoff gegen den Influenza-Virus- Subtyp A (H7N9) steht bislang nicht zur Verfügung. (eb)
Die Autoren arbeiten für das CRM (Centrum für Reisemedizin in Düsseldorf)