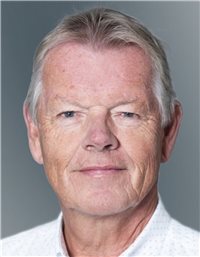Blutdruck-Therapie
Diuretika nur für Dicke?
Die Körperfülle eines Menschen hat möglicherweise einen Einfluss darauf, wie effizient bestimmte Blutdrucksenker Infarkte vorbeugen. Das zeigen neue Studienergebnisse.
Veröffentlicht:
Es bleibt ungeklärt, warum manche Blutdrucksenker bei Dicken besser zu wirken scheinen.
© Arteria Photography
NEW YORK. Das Körpergewicht ist gemeinhin kein Differenzialkriterium für die Wahl eines Antihypertensivums.
Gleichwohl ist in Studien bei Patienten mit KHK oder Hypertonie wiederholt beobachtet worden, dass die Rate kardiovaskulärer Ereignisse bei fettleibigen Menschen niedriger war als bei schlanken.
Unklar ist, was diesem als "obesity paradox" bekannten Phänomen zugrunde liegt.
Studienteilnehmer in drei Gewichtskategorien zugeordnet
Könnte es sein, dass unterschiedliche Blutdrucksenker je nach Gewichtskategorie der Patienten unterschiedlich wirksam sind? Dieser Frage ist eine Forschergruppe in einer Analyse von Daten der ACCOMPLISH-Studie nachgegangen (Lancet, online 6. Dezember).
In dieser Studie sind bekanntlich zwei Blutdrucksenker-Kombinationen - der ACE-Hemmer Benazepril, entweder kombiniert mit Amlodipin oder dem Thiaziddiuretikum HCTZ - in ihrer Wirkung auf kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität bei mehr als 11.000 Patienten mit Hypertonie und weiteren Risikofaktoren verglichen worden.
Für die aktuelle Analyse hat die Studiengruppe alle Teilnehmer auf Basis ihres Body-Mass-Indexes (BMI) drei Gewichtskategorien zugeordnet, nämlich Fettleibigkeit (n=5709), Übergewicht (n=4157) und Normalgewicht (n=1616).
Dann wurde nach der Höhe der Ereignisraten (kardiovaskulärer Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall) in diesen Gewichtklassen in Abhängigkeit von der Kombi-Therapie geschaut.
Dicke Menschen: Diuretikum "ein logischer Ansatz"
Die Benazepril/Amlodipin-Kombi erwies sich in allen Gewichtsgruppen als nahezu gleich effektiv. Anders die Benazepril/HCTZ-Kombi: Unter dieser Therapie war die Ereignisrate in der Gruppe der Schlanken signifikant höher als in der Gruppe der Fettleibigen (Risikoerhöhung: 68 Prozent).
Die Zahl der Ereignisse pro 1000 Personenjahre lag bei 30,7 (Normalgewicht), 21,9 (Übergewicht) und 18,2 (Fettleibigkeit).
Bei schlanken Hypertonikern reduzierte die Benazepril/Amlodipin-Kombi das Risiko um 43 Prozent stärker als die Benazepril/HCTZ-Kombi.
Somit scheint das Diuretikum zwar bei Fettleibigkeit von ähnlicher protektiver Wirksamkeit zu sein wie der Kalziumantagonist; bei Patienten mit Normalgewicht schwächt sich diese Wirkung aber offenbar deutlich ab.
Erhöhte Plasma- und Herzminutenvolumina seien pathophysiologische Charakteristika der Hypertonie bei Fettleibigkeit. Hier sei das Diuretikum "ein logischer Ansatz", so die Autoren.