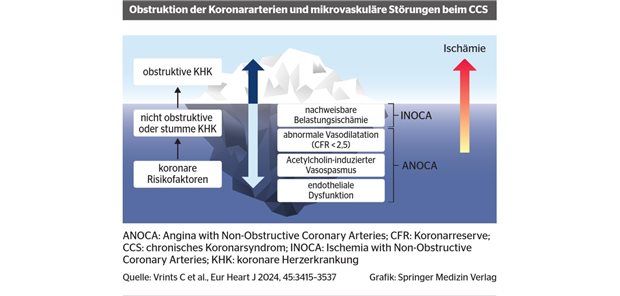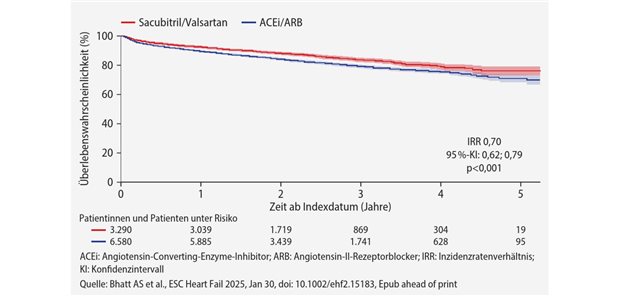Bei Herzinsuffizienz ist Thromboserisiko erhöht
BASEL (sko). Jährlich sterben in Deutschland 40 000 Menschen an einer Lungenembolie, und bei 75 Prozent von ihnen geschieht das nicht nach einer Operation. Wer überlebt, hat häufig Folge-Erkrankungen: Nach zwei Jahren kommt es bei vier Prozent zu einer sekundären pulmonalen Hypertonie.
Veröffentlicht:Daher sollten Patienten mit hohem Thromboserisiko und internistischen Erkrankungen wie Herzleiden oder Krebs eine effektive Thrombose-Prophylaxe erhalten. Das Risiko für Thromboembolien ist bei bestimmten internistischen Erkrankungen deutlich erhöht. Hierzu zählt Dr. Holger Lawall vom Klinikum Karlsbad-Langensteinbach etwa Herzinsuffizienz, Karzinome, akute Infektionen, Schlaganfall, rheumatische sowie akute Atemwegserkrankungen.
Besonders kritisch wird es, wenn mehrere Risikofaktoren zusammentreffen: "Es hat sich herausgestellt, daß 66 Prozent der Patienten mit einer tiefen Beinvenenthrombose zwei oder sogar mehr Risikofaktoren haben", sagte Lawall bei der vom Unternehmen Sanofi-Aventis organisierten Veranstaltung in Basel.
Das Risiko einer Thromboembolie läßt sich durch eine geeignete Prophylaxe vermindern. "Bei den niedermolekularen Heparinen ist die Datenlage zur Zeit am besten", sagte Lawall. So betrug in der MEDENOX-Studie die relative Risikoreduktion durch die Hochdosisbehandlung mit einmal täglich 40 mg Enoxaparin (Clexane®) subkutan 63 Prozent.
Mit Enoxaparin traten 5,5 Prozent und mit Placebo 14,9 Prozent thromboembolische Ereignisse auf. Die niedrigere Dosis von 20 mg Enoxaparin war in dieser Risikogruppe nicht ausreichend. An der Studie hatten 1100 Patienten teilgenommen, die wegen einer internistischen Erkrankung weitgehend bettlägerig waren (die "Ärzte Zeitung" berichtete).
Wie die Thromboseprophylaxe bei nicht operierten Patienten ablaufen kann, verdeutlichte Lawall am Beispiel des Schlaganfalls: "Wir beginnen mit der Prophylaxe, sobald der Zeitraum für die Lyse überschritten ist und diagnostisch sicher geklärt ist, daß keine weitere Thrombolyse erfolgen wird", schilderte Lawall sein Vorgehen. Nach der aktuellen Datenlage sei dann eine Prophylaxe-Dauer von zehn bis 14 Tage empfehlenswert.