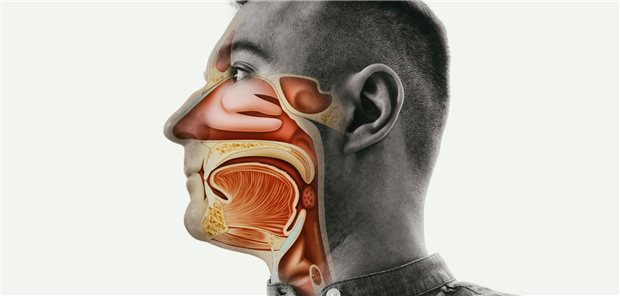Forschung
Neuer Ansatz zur Therapie der diastolischen Herzschwäche
Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover haben möglicherweise einen Weg gefunden, wie sich krankhafte Umbauprozesse des Herzens vermeiden lassen.
Veröffentlicht:
Der diastolischen Herzschwäche liegt eine Fibrosierung des Gewebes zugrunde.
© diez-artwork / Fotolia
HANNOVER. Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben im Mausmodell einen neuen Ansatz für die Therapie der diastolischen Herzschwäche entdeckt: Die Herzfunktion verbesserte sich, wenn sie eine bestimmte sogenannte "lange nichtkodierende RNA" (lncRNA) hemmten, wie die MHH berichtet. lncRNA sind Ribonukleinsäuren, die Vorgänge in den Zellen regulieren, wobei die Zusammenhänge bisher größtenteils noch unbekannt sind. Die Forschungsergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler jüngst im Fachjournal "Circulation Research" (doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.310624).
Die MHH-Forscher haben gezielt die Bindegewebszellen im Herzen untersucht. Denn bei der diastolischen Herzinsuffizienz kommt es vor allem zu einer Fibrosierung des Herzgewebes. Durch die Gewebesteifigkeit füllt sich dann auch das Herz nicht ausreichend mit Blut und und in der Folge kommt es zur Leistungsschwäche, zu Kurzatmigkeit und Herzrythmusstörungen. Im Gegensatz zur systolischen Herzschwäche ist die Muskelkraft des Herzens aber normal, wie die Forscher erinnern.
Eine wichtige neue Erkenntnis war nun: Zu Beginn der Erkrankung kommt in den Fibroblasten vermehrt die lncRNA Meg3 vor. Diese lncRNA reguliert die Produktion der Metalloproteinase-2 (MMP-2) in der Matrix, die für die Fibrosierungsprozesse wesentlich ist .
Als die Forscher Meg3 ausgeschaltet hatten, kam es tatsächlich einer Downregulation der MMP-2-Transkription und in der Folge zu einer verminderten kardialen Fibrosierung und einer verbesserten diastolischen Funktion des Herzens. Die Forscher hoffen nun, diesen Therapieansatz so weit entwickeln zu können, dass er auch bei Patienten angewendet werden kann. (run)