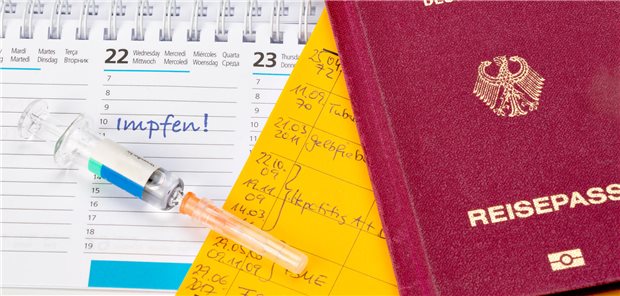Aktuelle Studie
Tourismus trägt multiresistente Erreger in alle Welt
DÜSSELDORF. Eine aktuelle Studie bestätigt, dass internationale Reisen erheblich zur Entstehung und Verbreitung multiresistenter Erreger beitragen (Lancet Infect Dis 2016; Online 14. Oktober), teilt das CRM Centrum für Reisemedizin mit. 34 Prozent der international Reisenden, die zuvor frei von ESBL-bildenden Bakterien waren, kehren mit einem Befall dieser Keime in ihre Heimatländer zurück; bei 11,3 Prozent sind sie selbst nach zwölf Monaten in der Heimat noch nachweisbar.
In Südostasien, Zentralasien und Nordafrika ist das Risiko, sich ESBL-bildende Keime einzufangen, besonders hoch. Das Risiko erhöhte sich zudem, wenn Reisende unterwegs Antibiotika eingenommen oder an Reisedurchfall gelitten hatten, so das CRM. Auch Menschen, die an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung leiden, tragen ein höheres Risiko, auf Reisen multiresistente Keime zu erwerben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erreger von Reiserückkehrern an ein Haushaltsmitglied übertragen werden, liegt bei rund zwölf Prozent.
"Wir brauchen bei Ärzten und Reisenden mehr Bewusstsein für die Problematik der auf Fernreisen erworbenen und hierzulande weiterverbreiteten multiresistenten Erreger", wird Professor Tomas Jelinek, Wissenschaftlicher Leiter des CRM, in der Mitteilung zitiert. International Reisende sollten etwa während und nach der Reise auf besonders sorgfältige Hygiene achten. "Die meisten Keime werden über die Hände übertragen. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt gefährdete Personen im Umfeld bis zu einem gewissen Grad", so Jelinek.
Aber auch die Vermeidung von Reisedurchfall durch sorgfältige Lebensmittelhygiene sei wichtig. Falls nach der Reise ein Arzt- oder Klinikbesuch ansteht, sollten Reiserückkehrer die Ärzte darauf hinweisen, dass und wann sie im Ausland waren. "Doch auch Ärzte sind gefragt: Bei der Aufklärung von Reisewilligen über Risikofaktoren, aber auch bei der Berücksichtigung möglicher importierter Resistenzen bei Reiserückkehrern. Diese müssen sowohl bei der Behandlung der Reisenden selbst, als auch als potenzielle Gefahr für andere Patienten – etwa bei Krankenhausaufenthalten – mehr in den Blick rücken", so Jelinek. (eb)