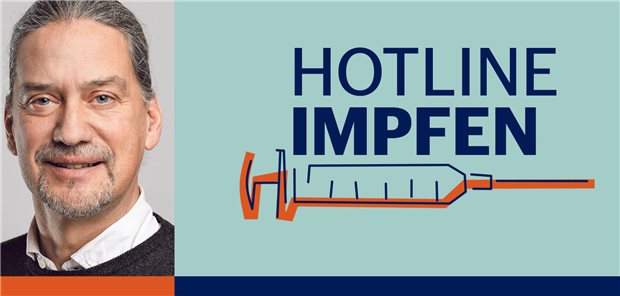Chronisch Kranke
Welche Impfungen sind sinnvoll?
Neben den Standardimpfungen empfiehlt die STIKO zusätzliche Impfungen bei nahezu allen chronischen Erkrankungen. Doch gerade diese besonders gefährdeten Patienten sind häufig nur unzureichend geschützt.
Veröffentlicht:
Patienten mit Neoplasien oder chronischen neurologischen Krankheiten sollten eine einmalige Indikationsimpfung gegen Pneumokokken erhalten.
© Mathias Ernert
NEU-ISENBURG. Immer wieder unterbleiben Impfungen, weil Immundefekte oder chronische Erkrankungen irrtümlich als Kontraindikationen angesehen werden.
Dabei warnt die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut ausdrücklich vor schweren Verläufen und Komplikationen gerade innerhalb dieser Personengruppen bei Krankheiten, die durch Impfungen verhindert werden könnten.
Zudem weisen die STIKO-Experten darauf hin, dass "keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorliegen, dass eventuell zeitgleich mit der Impfung auftretende Krankheitsschübe ursächlich durch eine Impfung bedingt sein könnten" (Epidemiologisches Bulletin 25. August 2014 / Nr. 34; Epidemiologisches Bulletin. 20. Februar 2012 / Nr. 7).
Generell sollen Patienten mit chronischen Erkrankungen alle Standardimpfungen nach dem Impfkalender durchlaufen. Hierzu gehört seit 2009 bei Erwachsenen auch die einmalige Pertussisimpfung. In naher Zukunft will sich die STIKO zudem mit der Frage nach einer Empfehlung der Herpes-zoster-Impfung befassen.
Die Indikationsimpfungen, die Personen mit chronischen Erkrankungen über die Standardimpfungen hinaus erhalten sollten, beziehen sich im Wesentlichen auf den Schutz vor Atemwegsinfektionen.
Für Personen ab 60 Jahren stehen diese Impfungen ohnehin auf dem Kalender. Bei Hämophilie und Lebererkrankungen werden zudem Impfungen gegen Hepatitis A und bei Dialysepflicht gegen Hepatitis B empfohlen.
Schutz vor invasiven Pneumokokken
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit chronischen Krankheiten wie Atemwegs-, Herz-Kreislauf-, Nieren- oder Lebererkrankungen, Diabetes mellitus oder anderen Stoffwechselstörungen rät die STIKO zu der in der Regel einmaligen Indikationsimpfung gegen Pneumokokken. Gleiches gilt für Patienten mit Neoplasien oder chronischen neurologischen Krankheiten.
Eine englische Studie mit Zwei- bis 15-Jährigen hat ergeben, dass das Risiko für eine invasive Pneumokokkenerkrankung bei chronischen Krankheiten der Leber, der Niere oder der Atemwege besonders hoch ist (Journal of Infection 2012; 65(1): 17-24).
Kinder mit Asthma oder Diabetes mellitus hatten in der Altersgruppe ab fünf Jahren ein etwa vierfach erhöhtes Risiko für eine invasive Pneumokokkeninfektion.
Risikopatienten bis zu einem Alter von einschließlich vier Jahren sollen mit dem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV13) geimpft werden. Ab fünf Jahren kann auch der 23-valente Polysaccharid-Impfstoff (PPV23) eingesetzt werden, der für die über 60-Jährigen von der STIKO nach wie vor als Standardimpfstoff empfohlen wird.
Liegen angeborene oder erworbene Immundefekte oder chronische Nierenerkrankungen vor, sind möglicherweise eine oder mehrere Wiederholungsimpfungen nötig. Bei Erwachsenen und Kindern ab zehn Jahren erfolgen diese dann im Abstand von fünf Jahren, bei Kindern unter zehn Jahren nach mindestens drei Jahren.
Auch eine sequenzielle Impfung kann laut STIKO sinnvoll sein. In diesem Fall wird empfohlen, bei ungeimpften Personen mit dem 13-valenten Konjugatimpfstoff zu beginnen, gefolgt von PPV23, mit einem Mindestabstand von zwei Monaten. Experten zufolge scheinen die Vorzüge der Konjugatimpfstoffe zu überwiegen.
Seit 2013 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Impfung mit PCV13 auch für Menschen ab 60 sowie Risikopatienten ab 50 Jahren.
Zusätzlich gegen Influenza impfen
Der zusätzliche Nutzen einer Simultanimpfung gegen Pneumokokken und Influenza konnte in einer französischen Studie mit Probanden ab 65 Jahren nachgewiesen werden (Hum Vaccin Immunothera 2013; 9: 128-135).
Sowohl gegenüber alleiniger Pneumokokken- als auch alleiniger Influenzaimpfung senkte eine Simultanimpfung die Ein-Jahres-Gesamtmortalität signifikant.
Die STIKO empfiehlt für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens zusätzlich zur Impfung gegen Pneumokokken die jährliche Influenzaimpfung.
Indiziert ist diese unter anderem bei chronischen Krankheiten der Atmungsorgane einschließlich Asthma und COPD, chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenleiden, Stoffwechselerkrankungen sowie chronischen neurologischen Erkrankungen.
Ältere nicht zu früh impfen!
Bei der Impfung von Älteren und chronisch Kranken muss grundsätzlich beachtet werden, dass die Antikörpertiter oft schneller wieder abfallen als bei Jüngeren und Gesunden.
So waren in einer Studie mit älteren COPD-Patienten 24 Wochen nach der Impfung mit einer MF59-adjuvanzierten Influenza-Vakzine die Titer wieder auf Ausgangsniveau und der Impfschutz damit trotz des stärker immunogenen Vakzins nicht mehr ausreichend (Der Pneumologe 2014; 6: 478-485).
Deshalb sollte der Impfzeitpunkt nicht zu früh gewählt werden, meinen Anja Kwetkat und Kollegen von der Uni Jena. November oder Dezember seien ideal für die Grippeimpfung bei diesen Patienten.
Angesichts hoher Verbreitungsraten von 20 bis 35 Prozent für die Influenza im Kindesalter wird die Impfung vor allem bei respiratorischen und/oder immunologischen Grundkrankheiten empfohlen.
Säuglinge und Kleinkinder erhalten zunächst zwei Teildosen eines hochimmunogenen Influenzaimpfstoffes im Abstand von etwa vier Wochen, um eine belastbare Immunität aufzubauen.
Ab neun Jahren ist die zweite Impfdosis überflüssig, da man davon ausgeht, dass bis dahin auch nicht geimpfte Kinder bereits eine gewisse Basisimmunität erworben haben (Monatsschr Kinderheilkd 2014; 162: 115-121).
Grippeimpfstoffe mit verbesserter Wirksamkeit wurden auch für junge Patienten entwickelt. Ab sechs Monaten ist der Impfstoff Virosomal zugelassen. Sofern keine Kontraindikationen bestehen, können Kinder und Jugendliche von zwei bis 17 Jahren sowohl mit einem inaktivierten Impfstoff (TIV) als auch mit einem attenuierten Influenza-Lebendimpfstoff (LAIV) geimpft werden.
In der Altersgruppe von zwei bis sechs Jahren empfiehlt die STIKO, bevorzugt LAIV einzusetzen. Bei Kindern und Jugendlichen mit klinischer Immunschwäche und Asthma oder akutem Giemen ist LAIV kontraindiziert.