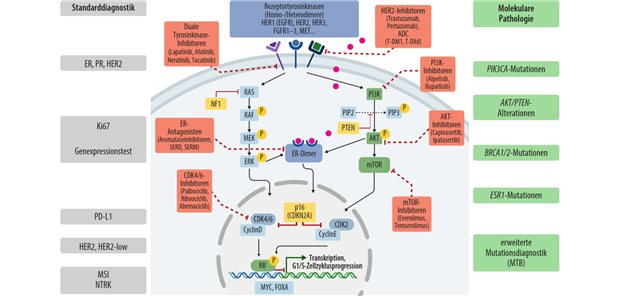Neue Diskussion
Führt Brustkrebsscreening vor allem zu Überdiagnosen?
Mehr als 80% der beim Screening aufgespürten Tumoren unter 2 cm seien harmlos und würden von allein wieder verschwinden, schreiben US-Forscher aufgrund einer aktuellen Analyse. Damit ernten sie bei Kollegen jedoch harsche Kritik.
Veröffentlicht:
Experten streiten erneut über den Nutzen des Mammografie-Screenings.
© Bernd Wüstneck / dpa
LEBANON/USA Seit das Mammografie-Screening in den meisten Industrieländern etabliert wurde, tobt ein Streit unter Experten, ob solche Untersuchungen Frauen überhaupt nützen oder doch mehr schaden. So könnten häufig Tumoren entdeckt werden, wo keine sind, auch könnten die aufgespürten Geschwülste oft harmlos sein. Dank Screening erzeugen sie jedoch Ängste und Narben auf Brust und Seele.
Einig sind sich die Experten immerhin darin, dass die Brustkrebsmortalität seit der Einführung des Screenings deutlich zurückgegangen ist, was die Befürworter als klares Indiz für dessen Nutzen bewerten.
Die Gegner behaupten hingegen, die verbesserte Prognose sei vor allem besseren Therapien zu verdanken und weniger dem Screening.
Die Wahrheit lässt sich jedoch nur schwer eruieren, da es ja kein screeningfreies Paralleluniversum gibt, das als Vergleich herhalten könnte. Also bemüht man Berechnungen basierend auf Inzidenzraten vor Einführung des Screenings. Je nachdem, welche Werte solchen Berechnungen zugrunde liegen, ist das Screening unglaublich erfolgreich oder aber ein Flopp.
Inzidenz großer Tumoren kaum gesunken
Letzteres vermutet ein Team um Dr. Gilbert Welch vom "Institute for Health Policy and Clinical Practice" in Lebanon. Die Gesundheitsforscher hatten sich in einer aktuellen Analyse Angaben zur Tumorgröße aus der US-Datenbank SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) vorgeknöpft.
Die Idee dahinter: Das Screening verspricht invasive Tumoren früh aufzuspüren – noch bevor sie groß sind und Probleme bereiten. Folglich sollten durch das Screening Anteil und Inzidenz von großen Tumoren zurückgehen und von kleinen steigen.
Bei der relativen Häufigkeit war genau das zu beobachten: In der Referenzperiode 1975 bis 1979, also noch vor Einführung des Screenings, waren 37% der aufgespürten invasiven Tumoren kleiner als 2 cm, nach Beginn der Massenmammografie stieg der Anteil bis auf 68% im Jahr 2012, entsprechend fiel der Anteil größerer Tumoren von 64 auf 32%.
Wenig überraschend schoss nach Beginn des Screenings die Inzidenz kleinerer Tumoren in die Höhe, allerdings – und das ist der entscheidende Punkt – sank die altersadjustierte Inzidenz größere Tumoren kaum.
Ein deutlicher Rückgang wäre aber erwartet worden, schließlich sollte das Screening ja die Entstehung größerer Tumoren verhindern.
Für diese Fakten gibt es nun zwei verschiedene Erklärungen: Entweder gehen dem Screening kritische schnellwachsende Tumoren nach wie vor durch die Lappen – dann würde das Verfahren lediglich einen Haufen harmloser Geschwülste identifizieren. Oder aber die Tumorinzidenz ist in den vergangene Dekaden deutlich gestiegen.
In diesem Fall würde das Screening dazu beitragen, dass die Inzidenz großer Tumoren nicht weiter zunimmt.
70.000 falsche Brustkrebsdiagnosen im Jahr?
Welch und Mitarbeiter sehen keine Hinweise auf eine erhöhte Tumorinzidenz, sie gehen also davon aus, dass Frauen heute ein ähnlich großes Brustkrebsrisiko tragen wie in den 1970er-Jahren. Unter dieser Annahme sind die Resultate fürs Screening in der Tat sehr bescheiden.
So fiel die Inzidenz größerer Tumoren im Beobachtungszeitraum von 145 auf 115 pro 100.000 Frauen, gleichzeitig stieg die Inzidenz kleinerer Tumoren von 82 auf 244 pro 100.000 Frauen. Es werden also 30 große Tumoren weniger, dafür 162 kleine Tumoren mehr als früher erkannt. Die Differenz – das sind 132 Tumoren – wäre demnach überdiagnostiziert.
Dabei müsse es sich letztlich um Tumoren handeln, die nie Probleme bereiten und von selbst wieder verschwinden würden, mutmaßen die Studienautoren. Das wären immerhin 81% der kleinen und 37% aller invasiven Brusttumoren. Jedes Jahr würde demnach bei 70.000 Frauen in den USA fälschlicherweise eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert.
Die Forscher um Welch sehen auch keinen großen Nutzen bei der Sterberate. So ist die Zehn-Jahres-Mortalität für große Tumoren zwischen Mitte der 1970er-Jahre und den ersten Jahren des neuen Jahrtausends bei größeren Tumoren um etwa 30–40% gesunken.
Das wird vor allem auf die bessere Therapie zurückgeführt, da bei großen Tumoren kein Nutzen des Screenings zu erwarten ist. Bei kleineren Tumoren ist die Sterberate zwar weit stärker zurückgegangen – und zwar um die Hälfte bis drei Viertel, werden allerdings Überdiagnose sowie Verzögerungseffekte berücksichtigt – die Tumoren wären ja erst Jahre später klinisch auffällig geworden – dann wird nach Ansicht der Studienautoren auch hier kein übermäßig großer Vorteil des Screenings sichtbar.
Davon ausgehend, dass das Screening die Mortalität durch Vermeidung größerer Tumoren reduziert, konnte es zu Beginn noch etwa zwölf Todesfälle auf 100.000 Frauen vermeiden, inzwischen seien es dank besserer Therapien aber nur noch acht Todesfälle.
Bessere Therapie würden dagegen 17 Todesfälle pro 100.000 Frauen im Vergleich zu den 1970er-Jahren verhindern – zwei Drittel der Mortalitätssenkung geht nach den Berechnungen von Welch und Mitarbeitern also auf das Konto des Therapiefortschritts.
Die Forscher um Welch schlussfolgern, das Ausmaß der Überdiagnose beim Mammografie-Screening sei wohl noch stärker, der Nutzen auf die Mortalität dagegen weit geringer als bisher angenommen.
Doch keine konstante Brustkrebsinzidenz?
Solche Aussagen bleiben natürlich nicht unwidersprochen. Auf dem Radiologenportal AuntMinnie.com* lässt der Harvard-Radiologe Professor Daniel Kopans mächtig Dampf ab. Er könne nicht verstehen, weshalb das "New England Journal of Medicine" diese Arbeit überhaupt publiziert habe.
Sie sei letztlich nur ein fader Aufguss einer ähnlichen Publikation aus dem Jahr 2012, und die sei schon damals von der falschen Annahme ausgegangen, dass die Brustkrebsinzidenz weitgehend konstant bleibe. Dies sei jedoch nicht der Fall. Kopans beruft sich auf das bereits sehr alte Connecticut Tumorregister.
Danach sei die Brustkrebsinzidenz seit 1940 pro Jahr um 1% gestiegen. Würden diese Zahlen zugrunde gelegt, sähe es mit dem Nutzen des Screenings schon ganz anders aus, dann wäre die Inzidenz invasiver Brusttumoren mittlerweile deutlich geringer als erwartet, auch sei dann ein markanter Rückgang der Brustkrebsmortalität durch das Screening zu beobachten.
Kopans glaubt auch aus anderen Gründen nicht an die Zahl von 70.000 falschen Brustkrebsdiagnosen im Jahr. "Bisher hat noch keiner einen mammografisch entdeckten invasiven Brusttumor jemals von sich aus verschwinden sehen."