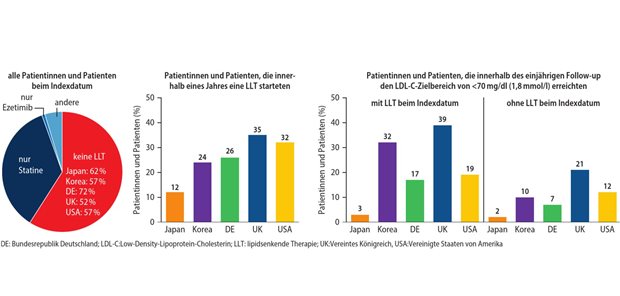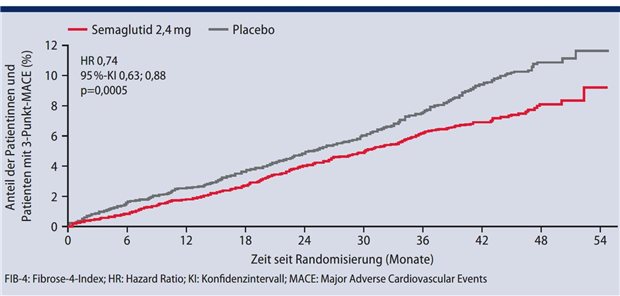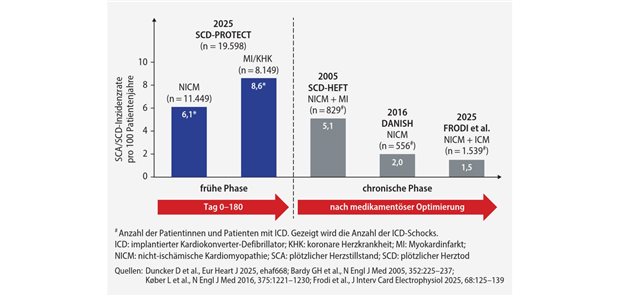Chronisch erschöpft - und dazu unverstanden
ME/CFS lauten die Kürzel für eine Krankheit, die bis heute rätselhaft ist: das chronische Erschöpfungssyndrom, im Englischen Chronic Fatigue Syndrome (CFS) oder myalgische Enzephalitis (ME). Die oft schwer kranken Patienten empören sich über das allgemeine Unverständnis.
Veröffentlicht:
Alltagstätigkeiten fallen CFS-Patienten - zu zwei Drittel sind es Frauen - so schwer wie anderen Menschen etwa eine Bergbesteigung. © bilderbox/Fotolia.de
© bilderbox/Fotolia.de
NEU-ISENBURG. Die englische Krankenschwester Florence Nightingale, berühmt geworden durch ihren Einsatz für verwundete Soldaten im Krimkrieg, wurde mit 35 Jahren von schwerer Erschöpfung befallen und war danach die 50 Jahre bis zu ihrem Tod bettlägerig. Die Begründerin der Pflegewissenschaften, deren Geburtstag am 12. Mai seit 1995 zum Internationalen CFS-Tag ausgerufen wird, ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Krankheit oft Menschen trifft, die mitten im Leben stehen. "Früher sprühte ich vor Energie, ich war sportlich, gesellig, zufrieden", erzählt eine Patientin. "Heute fühle ich mich ständig so, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen." CFS-Kranke sind durch starke Erschöpfung wie gelähmt, haben häufig Kopf-, Hals-, Gelenk- oder Muskelschmerzen, fühlen sich nach dem Schlafen nicht erholt, nach Anstrengungen noch schlechter, können sich kaum konzentrieren und haben Gedächtnisausfälle.
Den Kriterien zufolge beeinträchtigt CFS sowohl die körperlichen als auch die geistigen Fähigkeiten, ist nicht durch andere Ursachen bedingt, hat schlagartig begonnen und dauert seit mehr als sechs Monaten. Nach epidemiologischen Studien beträgt die Prävalenz 0,4 Prozent, in Deutschland leben schätzungsweise 300 000 Menschen damit, zwei Drittel sind Frauen. Meist erkranken sie im Alter von 30 bis 45 Jahren, und bloß ein Zehntel erholt sich wieder.
CFS lässt sich bislang nicht durch Labortests oder bildgebende Verfahren diagnostizieren. Erschwerend kommt hinzu, dass es mit unspezifischen Symptomen einhergeht. So hat bis zu einem Viertel aller Patienten, die einen Hausarzt aufsuchen, Erschöpfungszustände. CFS ist daher eine Ausschlussdiagnose nach Abklärung etwa von Aids, Anämie, Hepatitis, Diabetes, Fibromyalgie, HIV, Borreliose, Karzinome, MS, Parkinson, Schlafapnoe, Schilddrüsenüber- oder unterfunktion, von Ängsten oder Depressionen. Aber: Solche psychischen Störungen, die wie bei anderen chronischen Krankheiten bei einem Drittel der CFS-Patienten vorliegen, können sekundäre Reaktionen sein.
Wie die Krankheit entsteht, ist schleierhaft. Hypothesen zufolge wird das Immunsystem durch Zusammenspiel mehrerer Auslöser chronisch geschwächt oder aktiviert. Fast immer geht ein Infekt voraus. Im Verdacht: intrazelluläre Erreger wie Mykoplasmen, Chlamydien oder Borrelien, aber auch Viren wie das Epstein-Barr-Virus. Ende 2009 meldeten Forscher, sie hätten bei 67 Prozent der untersuchten CFS-Kranken das Retrovirus XMRV entdeckt, das sonst nur bei vier Prozent der Bevölkerung vorkommt. Doch womöglich verliert sich die Spur: In einer Studie von 2010 fand es sich bei keinem der 186 Patienten.
Eine ursächliche Behandlung existiert nicht, so behilft man sich, Mangelzustände auszugleichen, die Ernährung umzustellen, Immun-, Physio-, Psycho- oder Schmerztherapie zu machen. Auch können sich die Patienten im Sinne des Coping auf ihre Krankheit einstellen. Empfohlen wird außerdem das "Pacing": nur so weit aktiv zu sein, dass die individuelle Grenze nicht überschritten wird.
Die Folgen von CFS sind verheerend: Viele Patienten können über Monate und Jahre hinweg nicht arbeiten, ja kaum den Alltag bewältigen, selbst so einfache Verrichtungen wie Duschen oder Kochen werden zu einem Kraftakt. Kontakte zerbrechen, zumal Freunde und Bekannte das merkwürdige Verhalten nicht nachvollziehen können. Es ist dieses Unverständnis, das die Patienten in die Verzweiflung treibt und ihnen ebenso zusetzt wie die Symptome selbst. "Nur Einbildung", "rein psychisch", "lass dich nicht so hängen", lauteten die Kommentare, kritisiert das Bündnis ME/CFS. Auch Ärzten mangele es an Kenntnissen, oder sie zweifelten an der Existenz der Krankheit, dabei habe die WHO sie schon vor über 40 Jahren als Erkrankung des zentralen Nervensystems unter G 93.3 klassifiziert. Gegen diese Vorgabe verstießen die deutschen AWMF-Leitlinien mit der Einordnung als psychiatrische Krankheit. Tatsächlich handele es sich um eine organische, und zwar neurologische Störung.
Lesen Sie dazu auch: Chronisch erschöpft - und dazu unverstanden Bündnis ME/CFS macht eine erste öffentliche Aktion Gesprächstherapie bei CFS ohne Nutzen