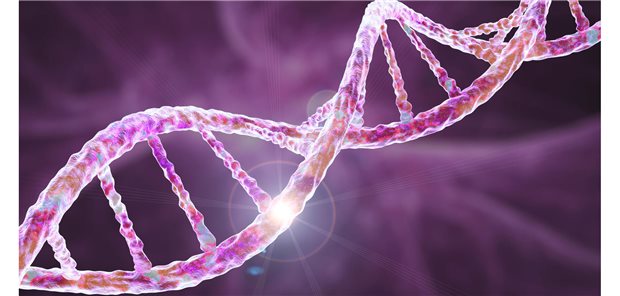Studie
Erst Intensivstation, dann PTBS
Jeder fünfte Patient, der auf einer Intensivstation behandelt wird, entwickeln im Anschluss eine posttraumatische Belastungsstörung.
Veröffentlicht:MÜNCHEN. Über posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) nach Intensivbehandlung berichtete Dr. Konrad Schmidt vom Institut für Allgemeinmedizin der Universität Jena auf der DEGAM 2013 in München. Ein Hausarzt sieht demnach jährlich zwei bis zehn dieser Patienten in seiner Praxis.
Für posttraumatische Belastungsstörungen werden in der Literatur Inzidenzen von 55,5% nach Vergewaltigung, 38,8% in Kriegen und 35,4% nach Misshandlungen in der Kindheit genannt.
Angesichts dieser Höchstwerte erscheint die Häufigkeit einer PTBS von 19-20% nach der Behandlung auf einer Intensivstation eine beachtliche Größe.
Doch bislang ist nur wenig über die Umstände bekannt, die zu posttraumatischen Symptome nach kritischen Erkrankungen führen.
Gefühle von Hilflosigkeit und Angst
Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden, erleben diesen Zustand häufig als klassische Krisensituation. Die Ungewissheit über die eigene Prognose, die Schmerzen, die häufige Unfähigkeit, sich mitzuteilen, der hohe Geräuschpegel, die Betriebsamkeit auf der Station und der daraus oft resultierende Schlafmangel, aber auch das Miterleben der Schicksale in den Nachbarbetten können Intensiv-Patienten traumatisieren.
Es entstehen Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein. Daraus resultierende Anpassungsstörungen sind vorübergehende Erscheinungen. Entwickelt sich eine akute Belastungsreaktion, kann diese in eine PTSD übergehen. Dabei steigt mit der Zahl der traumatischen Ereignisse die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten posttraumatischer Symptome.
Als typische Kennzeichen einer PTSD, so Schmidt, gelten Flash-back-Erlebnisse, physiologische Reaktionen bei Konfrontation, die Vermeidung von Gedanken und Gefühlen, die im Zusammenhang mit dem Trauma stehen, die emotionale Isolation und der soziale Rückzug sowie Ein- und Durchschlafstörungen, Labilität, Reizbarkeit, Wutausbrüche, Konzentrationsstörungen und Schreckhaftigkeit.
Aber nicht nur der Patient selbst ist betroffen, auch nahe Angehörige können eine Art PTSD entwickeln. Die Hilflosigkeit gegenüber den Leiden eines nahestehenden Menschen kann Ängste und depressive Symptome auslösen.
Auf der DEGAM 2013 in München machte Dr. Schmidt auch auf seine Interventionsstudie aufmerksam. Ersten Ergebnissen zufolge zeigten von 175 Überlebenden einer schweren Sepsis, die in die randomisierte offene Studie (Strukturierte Langzeitbeobachtung für Patienten nach Sepsis, SMOOTH) der Universität Jena nach ihrem Aufenthalt auf einer Intensivstation aufgenommen wurden, rund 20% posttraumatische Belastungssymptome.
Dabei nehme die Häufigkeit mit zunehmendem Alter etwas ab, so Schmidt. Ziel der Untersuchung sei u.a. die Identifikation möglicher Risikofaktoren, die zur Entwicklung posttraumatischer Symptome nach schwerer Sepsis beitragen.
Praxisrelevanz für den Hausarzt und Therapiemöglichkeiten
Von über 2,1 Mio. intensivmedizinischen Behandlungsfällen in Deutschland im Jahr 2011 mussten 374.488 Patienten beatmet werden. 30% aller Patienten mit schwerer Sepsis zeigten sechs Monate später klinisch relevante posttraumatische Symptome.
Bei ca. 58.000 Hausärzten in Deutschland ergeben sich daraus für jeden Hausarzt pro Jahr zwei bis zehn neue Patienten mit posttraumatischen Symptomen nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation.
In früheren Studien konnte bereits gezeigt werden, dass es Möglichkeiten gibt, die Entwicklung einer PTSD nach Intensivbehandlung im Vorfeld einzudämmen, beispielsweise mit einem Intensivtagebuch. In dieses tragen Pflegende und Angehörige die Ereignisse während der Zeit ein, in der der Intensivpatient z.B. beatmet wurde.
Nach dem Erwachen kann er das Tagebuch lesen und damit die Zeit seiner Bewusstlosigkeit rekonstruieren. So gelingt es ihm möglicherweise auch, etwaige traumhafte, als real eingestufte Erlebnisse aus der Erinnerung zu verarbeiten.
Doch wie kann der Hausarzt diejenigen Patienten herausfiltern, die Gefahr laufen, nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation eine PTSD zu entwickeln? Da die Betroffenen eine klassische Vermeidungshaltung zeigen, hilft nur aktives Ansprechen, meint Schmidt.
Dabei sei allerdings zu beachten, dass die typischen Symptome oft erst nach Monaten auftreten. Er empfiehlt ein generelles Kurzscreening für alle Patienten nach Intensivtherapie (Fragebogen kann vom Online-Portal der Uni Zürich /Psychologie heruntergeladen werden).
Schmidt geht davon aus, dass leichte Fälle im Sinne einer Anpassungsstörung bei entsprechender Schulung künftig vom Hausarzt behandelt werden können. Hierzu seien neben Tagebuchaufzeichnungen auch eine stabile Arzt-Patient-Beziehung und Empathie vonseiten des Arztes nötig. Die Ressourcen der Patienten müssten gestärkt werden und ggf. könne eine Pharma- und/oder Psychotherapie eingesetzt werden. (St)