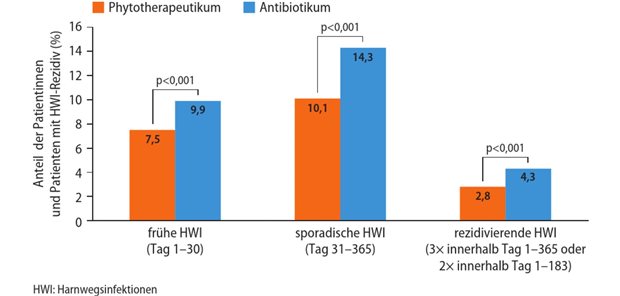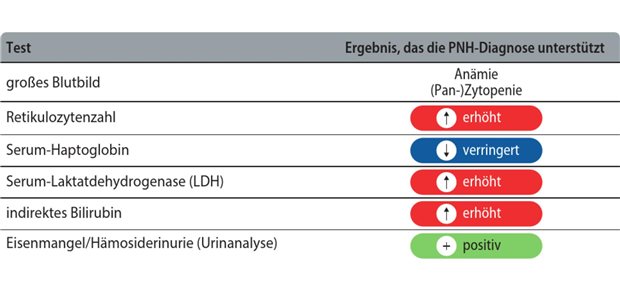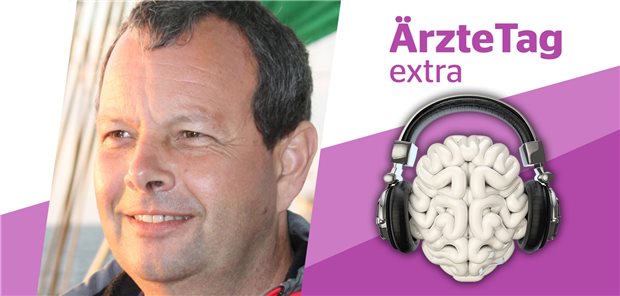"Male LUTS" löst in Leitlinie Begriff "BPH" ab
Blasenerkrankungen beim Mann müssen oftmals anders behandelt werden als bei Frauen - eine neue Leitlinie spricht deshalb jetzt von "Male LUTS".
Veröffentlicht:DRESDEN. Irritative Blasenbeschwerden bei Männern wie Pollakisurie, Nykturie und imperativer Harndrang sind oftmals auch auf eine überaktive Blase (OAB) zurückzuführen, und nicht nur auf eine vergrößerte Prostata. Daher benutzt die neue Leitlinie der European Association of Urology (EAU) nunmehr die Bezeichnung ‚Male LUTS‘ (Lower Urinary Tract Symptoms) als Oberbegriff und nicht mehr BPH. Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf die Behandlung, wie Experten beim Urologen-Kongress in Dresden erörtert haben.
Eine BPH führe bei etwa der Hälfte der betroffenen Männer zu einer tastbaren Prostatavergrößerung, erinnerte Dr. Matthias Oelke aus Hannover bei einer Bayer-Veranstaltung. Es besteht jedoch kein sicherer Zusammenhang zwischen dieser benignen Vergrößerung und irritativen Blasensymptomen. "Männer mit großer Prostata können daher gänzlich symptomfrei sein, wie umgekehrt Männer mit kleiner Prostata möglicherweise eine ausgeprägte Symptomatik aufweisen."
Zwar kann eine BPH zur "Bladder Outlet Obstruction" (BOO) führen, aber auch hier ist der Zusammenhang zwischen dem Grad der Obstruktion und dem Ausmaß der Symptome keineswegs korrelierend. "So haben gut die Hälfte der Männer mit einer BOO keine Beschwerden." Die neue, noch nicht veröffentlichte Leitlinie der EAU trägt dem Rechnung, indem sie eine Obstruktion der Blase nur noch als eine mögliche Ursache ansieht.
Privatdozent Christian Hampel aus Mainz erinnerte, dass Männer Ärzte meist wegen irritativer Blasenbeschwerden aufsuchen. Pollakis- und Nykturie sowie imperativer Harndrang sind aber oftmals durch das Krankheitsbild einer OAB charakterisiert mit einer Detrusor-Überaktivität. Diese Erkrankung ist, wie die EPIC-Studie zeigte, bei Männern und Frauen bis zum 70. Lebensjahr gleich häufig.
Bei einer OAB aber, so Hampel weiter, sind Anticholinergika indiziert, die durchaus auch bei einer Mischätiologie mit Alpha-Blockern zusammen gegeben werden können. Weitestgehend kontraindiziert sind Anticholinergika jedoch bei Vorliegen einer gravierenden Obstruktion, etwa mit einer Restharnmenge von 100 ml und darüber. Da anticholinerge Medikamente zu einer verminderten Innervation des Detrusors führen, besteht sonst die Gefahr eines zunehmenden Harnverhalts.
Bei der Wahl des Anticholinergikums ist seine Selektivität in Bezug zu bestimmten Muskarin-Rezeptoren durchaus von Belang, wie Hampel betonte. Hier ist ein Präparat von Vorteil, welches wie Darifenacin (Emselex®) eine starke Affinität zum M3-Rezeptor aufweist, da dadurch die im ZNS dominierenden M1-Rezeptoren nicht affiziert sind. Somit ist auch nicht mit kognitiven Einbußen zu rechnen, was besonders bei ältereren Patienten von großer Relevanz ist.