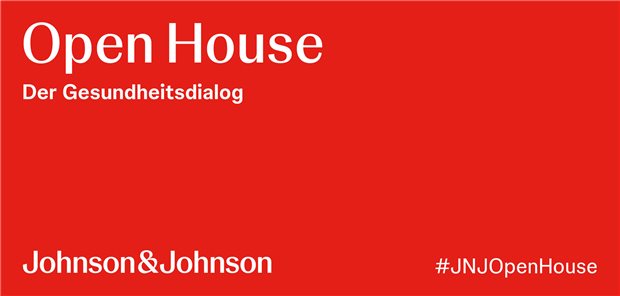Präventionsprogramm Alkohol
Damit Jugendliche klarer sehen
Betrunken oder vom Handy abgelenkt Auto fahren kann tödlich enden. Mit einem Besuch der Unfallstation will die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie Jugendliche für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren. Unfallopfer erzählen den Besuchern ihre Geschichten.
Veröffentlicht:
Besuch im Schockraum: „Traumaleader“ Dr. Klaus Peter Herms und Pflegeleiter Holger Westendorf erklären den Jugendlichen, wie Patienten zum Beispiel mit Polytrauma hier versorgt werden.
© Christian Benecker
"Ich habe die Wirklichkeit mitgebracht", sagt Markus Böhncke, Sicherheitsberater der Bremer Polizei, zu den jungen Besuchern im Bremer Klinikum Mitte (KBM). Und diese Wirklichkeit wird die jungen Leute, die in einem abgedunkelten Raum der Klinik sitzen, wenigstens so weit berühren, dass sie ihre Smartphones weglegen, mit denen sie anfangs gespielt haben. Nicht nur weil Böhnckes Unfallfotos beeindrucken können. Sondern auch, weil die Wirklichkeit die Jugendlichen auf einer mehrstündigen Tour durchs Krankenhaus in RTW und Schockraum, auf der Intensivstation und im Gespräch mit Unfallopfern unter die Haut kriechen soll.
Rund 30 Schülerinnen und Schüler der elften Klasse höherer Handelsschulen sind heute ins größte Bremer Krankenhaus gekommen. Mit dem Besuchsprogramm in der Unfallklinik will die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie deutschlandweit Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren vor Augen führen, wie es Verkehrsunfallverletzten ergeht: Schockraum, Intensivstation, Physiotherapie und langfristige Folgen des Unglücks. Name des Projekts: P.A.R.T.Y. ("Prevent Alcohol and Risk related Trauma in Youth"). Beim "Trauma-Rundgang" durch die Unfallklinik erfahren die Schüler, wie die Versorgung von schwerverletzten Unfallopfern abläuft. Das Ziel: Die jungen Leute sollen buchstäblich mit dem Schrecken davonkommen.
Begegnung mit der Katastrophe
Das Konzept setzt auf Begegnung mit dem echten Leben, mit echten Patienten, mit echter medizinischer Versorgung, echten Ärzten, Pflegern, Sanitätern – und echten Katastrophen. Deshalb sind auch Unfallopfer bei der Veranstaltung dabei. Sie sollen erzählen, wie es ihnen ergangen ist.
"Ich bin vom LKW überfahren worden", berichtet Janine Schulz, Kindergärtnerin, Reitlehrerin, eine junge Frau mit verschmitztem Lächeln. "Ich bin mit dem Fahrrad an der Ampel gestanden. Die war rot. Ich hab gewartet. Bei grün bin ich losgefahren und der LKW ist rechts abgebogen und ist über mich drüber gefahren. Ich hatte einen Trümmerbruch im Becken, diverse Beinbrüche, hauptsächlich rechts. Links war eigentlich nicht wirklich was gebrochen – oder?" Sie schaut zu Dr. Christiane Roos hinüber, der Unfallchirurgin. "Nee, links war nichts", sagt Roos. "Insgesamt war ich ein Jahr im Krankenhaus. Im Mai 2014 ist es passiert, dann Unfallkrankenhaus und dann im März des folgenden Jahre bin ich wieder hierher gekommen. Mir geht es heute gut. Jedenfalls gemessen an dem, was mir passiert ist. Ich kann laufen. Ich habe noch alle Körperteile. Ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich hab‘ die meiste Zeit keinen Schmerzen. Den Jugendlichen will ich sagen: Passt auf euch auf, passt auf die anderen im Straßenverkehr auf. Nur weil ihr Vorfahrt habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch Vorfahrt bekommt."
So ist die Wirklichkeit. Verkehrspolizist Böhncke zeigt nun seine Bilder. Das erste Foto fängt das Geschehen gut ein: Ein rotes Auto um den Pfeiler einer großen Verkehrstafel gewickelt. Das gelbe Licht der Straßenbeleuchtung. Sanitäter in grell reflektierenden Westen stehen scheinbar ratlos auf der gesperrten Straße. "Samstag Nacht, 2 Uhr", kommentiert Böhncke. "Ein Unfall. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Fahrer und Beifahrer tot." Ein weiteres Bild: Ein BMW, der von der Wucht des Unglücks in der Mitte zerrissen wurde. "Der Wagen war bei einem nächtlichen Wettrennen in der Stadt über 150 Stundenkilometer schnell gefahren. Die Trümmerteile haben wir über 160 Meter verteilt eingesammelt." Böhncke fürchtet keine Drastik. "Manchmal ist es schwer die Körper auseinanderzuhalten, die zermatscht im Auto sitzen."
Mit Handy am Steuer

Rettungsassistent Klaus Stiller und Rettungssanitäterin Karola Gerken mit Lehrer Jörn Eden, Ronja Reek auf der Liege, Cathrin Mahlstedt und Milena von Thaden. © Chr. Benecker
© Chr. Benecker
Die Jungs haben die Handys weggesteckt. Werden die Jugendlichen von den Worten, den Bildern erreicht? Auf die Fragen, welchen Wagen sie fahren, ob sie am Steuer telefonieren, ob sie schon mal zu schnell gefahren sind, antworten sie zäh oder gar nicht. Die Mädchen sagen, dass die Jungs mit ihren schnelle Wagen cool sein wollen. Das fänden sie aber gar nicht cool, fügen sie leutselig an.
Im vergangenen Jahr waren Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren bundesweit an 84.710 Verkehrsunfällen beteiligt. Vor allem junge Männer zwischen 18 und 24, so die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mit Alkohol oder Drogen im Blut und in aufgereizter Stimmung verschätzen sich die jungen Autofahrer bei der Geschwindigkeit oder in kritischen Situationen. Es starben im Jahr 2015 von den 18 bis 24 Jahre alten Verkehrsteilnehmern 473 junge Leute auf der Straße. 10.197 wurden schwer verletzt. Böhncke sagt: "Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, ist wieder einer aus eurer Altersgruppe tot."
Patient stirbt im Schockraum
Unfallchirurgin Roos, seit sieben Jahren am KBM, organisiert die P.A.R.T.Y. im Krankenhaus Bremen Mitte zum zweiten Mal. Sie sagt: "Die Jugendlichen beeindruckt es, wenn sie sehen, wohin ein einziger Moment der Unachtsamkeit führen kann." Im nächsten Jahr sollen es sechs Veranstaltungen werden. In diesem Jahr kommt man auf drei. Im Jahr 2016 zählte man im Bremer Krankenhaus Mitte 279 Schockraum-Alarmierungen, die anschließend intensivpflichtig waren. Davon waren 174 ein Polytrauma, in 47 Prozent verursacht durch Verkehrsunfälle. Der Rest hauptsächlich Stürze aus größerer Höhe. Drei bis fünf Patienten jährlich verlassen den Schockraum tot. Da wird Roos plötzlich ganz leise. "Das ist nicht witzig, wenn einem ein Patient im Schockraum stirbt."
Nun gehen die Jugendlichen in kleinen Gruppen durchs Haus: Intensivstation, Patientenbesuch, Rettungswagen, Physiotherapie. Dr. Klaus-Peter Hermes hat sich die Röntgenschürze mit der großen Aufschrift "Traumaleader" angezogen. Wir sind im Schockraum. Schläuche, Geräte, Fächer mit unverständlichen Aufschriften, Handschuhspender, künstliches Licht und Menschen in seltsamer Kleidung. Ungefähr so stellt man sich eine Raumkapsel von innen vor. Hermes fährt gerade mit dem Ultraschallkopf über den Bauch des Patienten, der vor ihm liegt. Er trägt den Kopf in einer Halskrause. Keine echter Patient diesmal, nur Tim, der Praktikant. "Die Milz, der Magen, die Nieren", sagt Hermes schnell. Die Schüler kommen nicht ganz mit und gucken verwirrt auf die verschwimmenden Konturen des Ultraschallbildes. Der Arzt schildert, wie hier schnell entschieden wird, wie die Verletzungen rasch erkannt werden müssen. Pflegeleiter Holger Westendorf fährt einmal zu Demonstrationszwecken mit dem Röntgengerät über Tim hin und her, vom Scheitel bis zur Sohle. Die Schüler haben ebenfalls die knöchellangen Schürzen angezogen. Ein bisschen sehen sie aus wie Novizen im Raum, die sie ja auch sind – und hier hoffentlich welche bleiben.
"Entspannt Euch mal!"
Alexandra Rinne, auch sie eine sehr junge Patientin, ist in ihrem im Auto verunglückt. Sie berichtet: "Mir ist einer auf meiner Fahrbahnseite entgegen gekommen und ich bin ausgewichen, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Von meinem Seat Ibiza ist nichts übrig geblieben. Ich war eingeklemmt. Ich weiß noch alles. Bis die Sanitäter gekommen sind. Und dann haben die mich mit Medikamenten halt abgeschossen und dann bin ich erst am nächsten Tag zu mir gekommen. Mein Kreuzbein war gebrochen, mein rechter Oberarm, meine beiden Oberschenkel, da waren offene Brüche. Und mein linker Unterschenkel war so zerstört, dass er amputiert werden musste. Ich trage seither eine Prothese." Das war am 2. November 2015, einen Tag vor ihrem Geburtstag. "Ich denke seit meinem Unfall anders nach über viele Sachen. Wenn Leute zum Beispiel wegen irgendwelcher Wehwehchen rumheulen, dann denke ich: Entspannt euch mal", sagt sie. Alexandra Rinne würde den Jugendlichen raten, im Straßenverkehr für die anderen mitzudenken.
Auf der Intensivstation bemüht sich unterdessen Professor Rolf Dembinski, medizinische Einzelheiten auf Besucherniveau zu bringen. "Heute haben wir einen Motorroller-Fahrer hier, der unter der Straßenbahn liegend gefunden wurde", sagt er, "da müssen wir natürlich gucken, wie es dem geht. Pumpt das Herz? Atmet er? Hat er vielleicht einen Pneumothorax – also die Luft an der falschen Stelle? Oder ist vielleicht das Gehirn angeschwollen?" Dann müsse man schnell handeln, sagt der Intensivmediziner. "Wir lassen möglichst den Druck raus, denn wenn die Gehirnzellen einmal weg sind, dann sind sie für immer weg." Dann gucken alle durch eine Glasscheibe in ein Krankenzimmer, wie mehrere Pfleger einen kreidebleichen, bewusstlosen alten Herrn versorgen. Ein Bild wie aus einem Stummfilm.
Das wird anders auf der Normalstation. Hier liegt Herr Ö. mit verletzten Armen und Beinen – aber mit klarem Kopf. "Ich hatte definitiv Glück", berichtet er. Ein Autofahrer kam ihm beim riskanten Überholen auf einer Fahrspur entgegen. Sein Motorrad flog mit ihm 70 Meter weit auf einen Acker. "Das Motorrad hat es in vier Teile zerlegt! Ich hatte zum Glück die Lederkombi an und einen Helm auf." Der Fahrer des Unfallautos war betrunken und floh in den Wald. Nun hofft der Patient, bald wieder stehen zu können. "Ich werde ja in drei Monaten heiraten", sagt er. Beklommen blicken die Schüler auf die Wunden des Patienten, seinen geschwollenen Arm, die Verbände.
Rettungssanitäter packen zu
Herr Ö. wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. Meistens aber sind die Rettungswagen bei Verkehrsunfällen im Einsatz. Die Schülerinnen lernen auch die zupackende Art der Rettungssanitäter kennen. Rettungsassistent Klaus Stiller und Rettungssanitäterin Karola Gerken sind mit ihrem RTW auf den Klinikhof gerollt. Hier demonstrieren sie, wie man Verletzte fachgerecht auf der Liege in einer Vakuummatratze fixiert und in den Rettungswagen schiebt. Eine der Schülerinnen, Ronja Reek, mimt die Verletzte. Lehrer Jörn Eden und die Schülerinnen steigen wie eine besorgte Familie in den Rettungswagen. Natürlich ist das wie ein Spiel. Aber dass niemand einen RTW nötig haben will ist auch klar.
Axel Wilhelm ist Sportlehrer und ebenfalls Unfallopfer. Während er berichtet, setzt er sich zwischendurch in seinen Rollstuhl.
"Ich bin zehn Meter weit geflogen"
"Ein Radsportunfall – am 1. August. 24 Grad im Schatten. Noch mal eine kurze Einheit für einen möglichen Triathlon-Wettbewerb! Richtig Gas geben! Ich bin richtig schnell gefahren! Keine gute Idee, wie sich herausgestellt hat. Ich meinte, die Situation überblicken zu können, dachte, ich hab's im Blick und könnte es einschätzen. Dann fuhr ich über eine Kreuzung in die grüne Ampelphase hinein. Und von rechts kam eine Fahrerin, die dachte, das schaff‘ ich noch, und ist über die Kreuzung geschossen. Und da haben sich dann zwei getroffen, die sich nicht gesehen haben. Ich wurde voll erwischt. Bin zehn Meter weit geflogen. Die nächste Erinnerung, die ich habe, war das Erwachen aus dem Koma. Polytrauma. Verletzungen von den Sprunggelenken bis zum Schädel." Das war am 1. August 2012. Es folgen zwei Monate Intensivstation. Ein Monat auf der Unfallchirurgie. Dann Unfallklinik. 33 Nachoperationen; der Weg ist noch nicht zu Ende. "Ich mache Gymnastik, Krafttraining, um den Alltag gut zu bewältigen. Trotzdem: Mir geht es heute relativ gut. Das Leben macht Spaß."
Das ist die zweite Nachricht, die die Schüler hören: Was ein ausgefeiltes Rettungssystem leisten kann. Schwerstverletzte finden zurück in ihren Alltag, wenn auch in einen beschädigten Alltag.
Am Schluss bleiben die Schüler zurückhaltend. "Warum habt ihr am Ende so zurückhaltend Rückmeldungen gegeben?", fragt Lehrer Jörn Eden später. Die Antwort: "Wir mussten gerade die Geschichte von Janina verstehen und selbst verarbeiten."
Lesen Sie dazu auch: Sicherheitsberatung : "Wir setzen auf Betroffenheit!"