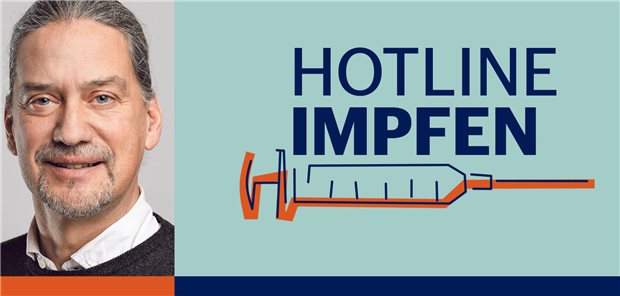Fukushima
Japan kämpft gegen die Strahlung
Zwei Jahre nach dem GAU in Fukushima ist Japan dabei, ganze Landstriche von den radioaktiven Strahlen zu befreien. Die ersten Bewohner dürfen zurück. Kritiker finden das verantwortungslos.
Veröffentlicht:
Eine Messung von Greenpeace am 26. Februar auf einem Parkplatz in Fukushima ergibt einen Wert von über 40 Mikrosievert pro Stunde.
© Lars Nicolaysen / dpa
FUKUSHIMA. Kratzend zieht der Baggerfahrer die Schaufel über die Erde. "Die Äste und Büsche auf dem Hang dort haben wir schon eingesammelt. Die Radioaktivität ist jetzt deutlich niedriger", erzählt der Japaner, der seinen Namen nicht nennen will, hinter einer weißen Atemschutzmaske.
Zwei Jahre nach dem GAU haben die staatlichen Behörden den Bewohnern seines Dorfes am Rande der Evakuierungszone im Umkreis von 20 Kilometern um die Atomruine Fukushima Daiichi erlaubt, wieder in ihre verlassenen Häuser zurückzukehren. Denn die Strahlung liegt hier weit unter dem für Evakuierungen geltenden Grenzwert von 20 Millisievert im Jahr.
Um sie weiter auf unter einen Millisievert zu senken, müssen die Menschen in dieser Gegend nahe der Stadt Tamura allerdings nun selbst dafür sorgen, die Häuser und Gärten zu dekontaminieren.
Überall sind Japaner in Straßenarbeiterkluft emsig damit beschäftigt, Häuser mit Papiertüchern abzuwischen, Gräser und Blätter aufzusammeln und die Erde - wo es geht - fünf Zentimeter tief abzutragen.

Dekontaminierungsversuche in Japan: Ein Mann entsorgt Ende Februar Gegenstände.
© EPA/FRANCK ROBICHON / dpa
Das Ganze wandert in große schwarze Säcke, die sich nun zu Tausenden als kleine Atommüllhalden in der ganzen Region stapeln, auf Feldern, Höfen und an Straßenrändern. Denn ein Zwischenlager gibt es noch immer nicht.
Aussichtsloser Kampf?
"Es wird zu viel Geld, Arbeitskraft und Zeit investiert, um diesen aussichtslosen Kampf in den hochkontaminierten Gebieten zu führen", kritisiert der Atomexperte Heinz Smital von der Umweltorganisation Greenpeace.
Kritiker vermuten, dass die Regierung von Premier Shinzo Abe die Auswirkungen des Atomunfalls herunterspielen will, indem sie die Menschen frühzeitig zurückkehren lasse. Auf diese Weise wolle sie den Widerstand gegen ein Wiederanfahren der nach dem GAU im ganzen Land abgeschalteten AKWs aufweichen. Andere vermuten, dass der Staat so zudem die horrenden Entschädigungen senken wolle.
Dabei sei schon das Wort "Dekontaminierung" irreführend, da diese Gegenden auch danach auf ewig weiter belastet seien, kritisiert Smital. Ein Sprecher des Umweltministeriums räumte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ein, dass die Methoden sicher nicht perfekt seien. Eine Dekontaminierung solchen Ausmaßes habe es aber auch noch nie zuvor gegeben.
Dekontamination läuft nicht immer nach Vorschrift
Hinzu kommt, dass die Dekontaminierungsarbeiten nicht immer nach Vorschrift laufen. Ein von einer staatlich beauftragten Baufirma angeheuerter Arbeiter führt zu einem bewaldeten Ort innerhalb der 20-Kilometer-Zone um das AKW, wo verstrahlte Erde illegal in einem Fluss entsorgt worden sei.
Die Arbeiter würden von den Subfirmen zudem finanziell ausgebeutet, beklagt Manabu Ohno. Der Staat sieht sich nicht in der Lage, die Arbeit überall zu überwachen.
Abgesehen davon ist es aus Sicht von Kritikern ohnehin gar nicht möglich, ganze Landstriche zu dekontaminieren.
Die japanische Regierung solle sich lieber auf die Stadt Fukushima konzentrieren, wo viele Menschen lebten und wo es zwei Jahre nach dem GAU zum Beispiel am Ende einer Rutsche auf einem Spielplatz noch immer "Hotspots" mit extrem hohen Strahlenwerten gebe, sagt Atomexperte Smital. "Das ist unerträglich".
Andere sprechen von Panikmache
Panikmache nennen das andere. Schließlich räumen auch Umweltschützer ein, dass die Werte im Stadtgebiet inzwischen allgemein so niedrig sind, dass Menschen hier wieder ihrem normalen Leben nachgehen können. Wer hätte das noch vor zwei Jahren gedacht?
Nach einer kurz vor dem zweiten Jahrestag der Katastrophe vorgelegten Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO ist das Krebsrisiko in den verstrahlten Gebieten nur leicht erhöht. Über einige unmittelbar verstrahlte Orte hinaus gab die WHO sogar Entwarnung: Umfangreiche Untersuchungen internationaler Experten hätten ergeben, dass die "vorhergesagten Risiken für die allgemeine Bevölkerung innerhalb und außerhalb Japans niedrig und keine messbaren Steigerungen der Krebsraten über das Basisniveau hinaus zu erwarten sind".
Während Greenpeace von einer Verharmlosung der Risiken spricht, werfen andere der WHO im Gegenteil sogar vor, Ängste ungerechtfertigt noch zu schüren. Glaubt man der Regierung von Ministerpräsident Abe, der ein erklärter Atombefürworter ist, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Ministerpräsident Abe spricht von "niedriger" Strahlendosis
"Die Strahlendosis, der die Menschen in Fukushima ausgesetzt waren, ist niedrig", versichert Kazuo Sakai vom nationalen Institut für Radiologie. Dass bei drei Kindern unter 18 Schilddrüsen-Krebs diagnostiziert wurde und bei sieben weiteren Personen ebenfalls Krebserkrankungen vermutet werden, könne nicht auf den GAU im Atomkraftwerk Fukushima zurückgeführt werden, so Sakai. Man habe keinerlei Folgen oder Schäden durch Radioaktivität festgestellt.
Derartige Äußerungen haben mit dazu beigetragen, dass Menschen mit Ängsten oft kaum noch mehr ernst genommen werden. "Die Atmosphäre ändert sich gerade derart, dass es immer schwerer wird, Befürchtungen zu äußern", schildert Yoshihiko Kanno der dpa. Seine 13-jährige Tochter habe ihm gesagt, dass sie aus Sorge über eine Stigmatisierung wegen der Verstrahlung niemals außerhalb Fukushimas heiraten werde.
"Die meisten Ärzte hier sagen, was die Regierung behauptet, dass es sicher sei. Viele vertrauen ihnen nicht", beklagt Hiroto Matsue im Gespräch mit der dpa. Er ist selber Arzt und arbeitete bis zu seiner Pensionierung fast 40 Jahre in einer renommierten Krebsklinik in Tokio. Heute fährt er jede Woche nach Fukushima, um besorgte Eltern und ihre Kinder in einer vom Staat unabhängigen Klinik zu betreuen, die diese aus Misstrauen gegen die Regierung und Ärzteschaft mit Spenden selbst finanziert haben.
Kinder mit Schilddrüsenveränderungen
Die meisten Kinder, die er hier untersuche, wiesen Veränderungen in der Schilddrüse auf. Ob es einen Zusammenhang mit dem AKW gebe, werde zwar schwer zu beweisen sein, sagt Matsue. Aber die Kinder müssten zumindest alle sechs Monate untersucht werden, und nicht alle zwei Jahre, wie der Staat behaupte.
"Kinder sollten in Fukushima gar nicht leben", sagt auch Katsutaka Idogawa, bis vor kurzem Bürgermeister der noch heute unbewohnbaren Stadt Futaba. "Sie sollten aus Fukushima gebracht werden, egal was das kostet", sagt Idogawa, der seine Mitbürger nach Saitama nahe Tokio evakuieren ließ, wo sie noch heute leben.
Doch Japans Medien ignorierten das Thema. "Ich habe immer wieder Regierungsvertreter aufgefordert, doch nach Fukushima umzuziehen, wenn sie der Meinung sind, dass das ein sicherer Platz zum Leben ist", sagt Idogawa. "Aber darauf habe ich nie eine Antwort erhalten". (dpa)