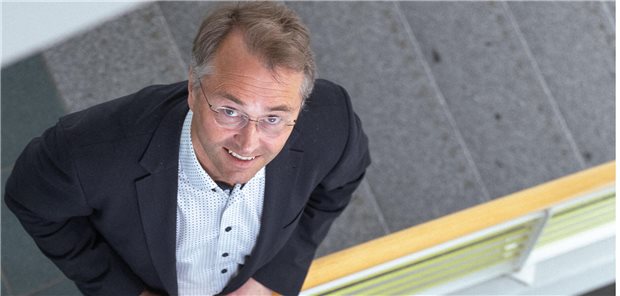DGIM-Kongress beginnt
"Das könnte sehr brisant werden!"
"Innere Medizin - vom Organ zum System" - so lautet das Leitthema des 119. Internisten-Kongresses, der vom 6. bis 9. April in Wiesbaden stattfindet. Welche Schwerpunkte gesetzt werden, worauf sich die Besucher besonders freuen dürfen und was neu ist, schildert Kongress-Präsidentin Professor Elisabeth Märker-Hermann im Interview mit der "Ärzte Zeitung".
Veröffentlicht:Prof. Elisabeth Märker-Hermann
Position: Chefärztin der Klinik Innere Medizin IV der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz, Wiesbaden
Klinische und wissenschaftliche Schwerpunkte: u.a.: M. Bechterew, andere HLA-B27-assoziierte Erkrankungen, Arthritis psoriatica, Rheumatoide Arthritis, Immunologische Erkrankungen, Genetik und Infektionen, SLE und Vaskulitiden
Ärzte Zeitung: Frau Professor Märker-Hermann, in Ihrer Video-Einladung zum DGIM-Kongress 2013 sprechen Sie davon, dass eine Änderung der Blickrichtung manchmal hilfreich sein könne. Wohin sollen denn die Kongressteilnehmer in diesem Jahr ihren Blick richten?
Professor Elisabeth Märker-Hermann: Nun, unsere Stammteilnehmer kennen immer nur die Bilder vom Kurhaus in Wiesbaden, von den Theaterkollonaden und den Rhein-Main-Hallen. Da wollten wir in dem Film mit dem Blick vom Neroberg einfach einmal eine andere Perspektive bieten.
Aber natürlich weist der Satz auf das Leitthema des DGIM-Kongresses hin: "Innere Medizin - vom Organ zum System", soll heißen: Wir Internisten dürfen nicht jeder nur auf sein Spezialgebiet schauen.
Vielmehr müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass besonders der chronisch kranke Patient immer ein Mensch als Ganzes ist mit vielen Facetten und einer Erkrankung, die fast immer auch andere Fachgebiete betrifft.
Im Jahr 2011 fand eine Mitgliederbefragung statt, deren Ergebnisse bei der Konzeption dieses Kongresses berücksichtigt werden sollten. Inwiefern ist das geschehen?
Ein spezieller Wunsch der Mitglieder war, verstärkt fachübergreifende Themen aufzugreifen. Wir behandeln deshalb in diesem Jahr bei deutlich mehr Symposien als früher Themen, die aus der Sicht verschiedener Fachrichtungen beleuchtet werden, sei es Fieber unklarer Genese, der Patient mit Oberbauchschmerzen oder auch die Transition von Forschungsergebnissen in die Praxis.
Die Symptom- und Pathogenese-orientierten Symposien werden also interdisziplinär abgehandelt. Ein Beispiel sind Interleukin-1-induzierte Erkrankungen - das ist etwas ganz Neues! Wir werden rheumatologische, infektiologische und Stoffwechsel-Aspekte diskutieren.
Ein weiteres Beispiel für die Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitgliederbefragung?
Wir sind auch dem Wunsch nachgekommen, mehr interaktive Falldiskussionen zu veranstalten. In zusätzlich sechs Symposien werden Kasuistiken ausgehend von einem Leitsymptom vorgestellt und können interaktiv mit TED-Abfragen durchgenommen werden.
Zudem sind Notfall- und Intensivmedizin sehr stark vertreten, eine Anregung, die wohl besonders von jungen Internisten in der Weiterbildung kam. Wer in der Notaufnahme einer Klinik arbeitet, erhält meist wenig notfallmedizinisches Hintergrundwissen. Dies bieten wir nun an.
Wollen die DGIM-Mitglieder also mehr praktisch nutzbares Wissen mit nach Hause nehmen und weniger Wissenschaft hören?
Unsere Erfahrung ist, dass einerseits der Bedarf an Hands-On-Kursen nicht zunimmt. Andererseits werden rein wissenschaftsorientierte Symposien mit Inhalten aus der Grundlagenforschung nicht gut angenommen.
Obwohl wir einen wissenschaftlichen Kongress veranstalten - und wir zeigen zum Beispiel in diesem Jahr 320 Poster - liegt für die meisten Teilnehmer der Schwerpunkt auf der Fort- und Weiterbildung, die über das eigene Schwerpunktfach hinausgeht.
Für grundlagenwissenschaftliche Themen besuchen die meisten bevorzugt Kongresse der internistischen Fachgesellschaften wie den unmittelbar vor dem DGIM-Kongress in Mannheim stattfindenden Kardiologenkongress. Beim DGIM-Kongress dagegen suchen die Kolleginnen und Kollegen Fort- und Weiterbildung auf hohem wissenschaftlichen Niveau - im Austausch mit anderen Disziplinen und Schwerpunkten.
Sie erwähnten die Notwendigkeit, verstärkt den ganzen Menschen im Blick zu haben. Nun ergeben sich aus dem Umgang mit chronisch Kranken besondere medizinisch-fachliche Anforderungen sowie erhöhte Anforderungen an das Arzt-Patienten-Verhältnis. Wird dieser Spagat, etwa vor dem Hintergrund zunehmender Arbeitsverdichtung, für den Einzelnen nicht immer problematischer?
Ich denke, das ist so. Der Arzt des chronisch Kranken in seinem Anspruch auf Menschlichkeit und Zuwendung hat immer eine Gratwanderung zwischen angemessener Empathie und Überlastung bis hin zum Burnout zu bewältigen.
Wir Ärztinnen und Ärzte wollen ein langjähriges und vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Patienten aufbauen, stehen aber in der Klinik wie in der Praxis unter erheblichem und zunehmendem Druck. Einem Druck, dem mancher nicht mehr gewachsen ist.
Es ist wichtig, dies auch berufspolitisch immer wieder neu zu artikulieren. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Vergütungs- und Erlössysteme dazu ihren Beitrag leisten. Denn diese bilden in den Kliniken, und nur dazu kann ich aus eigener Betroffenheit etwas sagen, die beratende, betreuende, die menschliche Funktion des Arztes und das intensive Gespräch eben nicht ab, während technische Leistungen und kurze Verweildauern in den Krankenhäusern belohnt werden.
Das hat zur Folge, dass Klinikverwaltungen von den angestellten Ärzten fordern, Patienten, die technische Leistungen benötigen und hohe Erlöse bringen, zu bevorzugen gegenüber Patienten, die multimorbide, chronisch krank, alt und stark versorgungsbedürftig sind.
Die zunehmende Subspezialisierung birgt ja auch die Gefahr eines eingeengten Sichtfeldes. Sie sprechen in Ihrer Kongresseinladung an, dass der Umgang mit multipel erkrankten Menschen vielfach von der Fachausrichtung des betreuenden Internisten abhänge. Müssen Internisten künftig mehr Verantwortung auch außerhalb ihres Spezialgebietes übernehmen?
Die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebendiagnose hängt wirklich oft zufällig davon ab, ob der Patient in der Rheumatologie oder in der Kardiologie aufgenommen wird. Auch in der Codierung wird nicht selten die "attraktivere" Diagnose als Hauptdiagnose angegeben.
In einem Symposium werden wir besprechen, ob die DRGs - also die Diagnosis Related Groups - unsere ärztlichen Entscheidungen beeinflussen. Das könnte politisch sehr brisant werden!
Es ist so, dass wir auch in der Versorgungsforschung erst allmählich verstehen, dass klinische und epidemiologische Studien nicht nur diagnose- und krankheitsbezogen durchgeführt werden dürfen, sondern dass man die komplexe Komorbidität in allen Belangen berücksichtigen muss.
Ein Beispiel...?
Zum Beispiel wissen wir erst seit fünf Jahren, dass das Vorhandensein einer Rheumatoiden Arthritis in gleicher Weise ein unabhängiges kardiovaskuläres Risiko darstellt wie das Vorliegen eines Diabetes mellitus.
Da kommt also ein Patient mit Herzinfarkt in die Klinik und als bekannte Risikofaktoren finden wir Rauchen, Diabetes, Hypertonie... Und als Nebendiagnose finden wir auf der Liste: Rheumatoide Arthritis.
Ich will damit sagen, dass eine Krankheit nicht nur deshalb als Nebendiagnose gelten darf, weil der Patient sie vielleicht schon seit zehn Jahren hat.
Denn diese "Nebendiagnose" könnte mit ein maßgeblicher Grund beziehungsweise ein wichtiger Risikofaktor für die akute Einweisung zum Beispiel wegen eines Herzinfarkts sein. Wir brauchen ein offenes Denken in Bezug auf die Begleiterkrankungen der immer älter werdenden Menschen.
Medizinisch-technische Fortschritte haben dazu geführt, dass früher streng getrennte Fachschaften heute eng kooperieren, etwa Herzchirurgie und Kardiologie oder Gastroenterologie und Viszeralchirurgie. Welche Konsequenzen hat das für die Aus- und Weiterbildung?
Es wäre günstig, wenn Vertreter dieser eng kooperierenden Fächer im Rahmen ihres Weiterbildungskatalogs eine Rotation in das jeweils andere Fach anbieten würden. Eigentlich hatten wir ja solche Rotationsprinzipien schon einmal: Wer früher Internist werden wollte, musste zum Beispiel eine Zeit lang in der Radiologie arbeiten.
Auf der anderen Seite gibt es ja bereits institutionalisierte gemeinsame Besprechungen wie das Tumorboard oder gemeinsame Visiten, die sich in den Krankenhäusern allmählich durchsetzen.
Dies ist im übrigen Teil der Qualitätskriterien, wie sie zum Beispiel onkologische oder kardiovaskuläre Zentren erfüllen müssen.
Meine Frage zielte zum Beispiel auch auf neue minimal-invasive Techniken, die einerseits Kenntnisse eines Chirurgen bedürfen, andererseits bisher bevorzugt von Internisten ausgeführt wurden, wenn man etwa an endoskopische Eingriffe und an NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) denkt. Man benötigt plötzlich Spezialisten, die in sich chirurgisches und internistisches Wissen vereinigen müssen...
Es gab im vergangenen Jahr eine Initiative, wonach man zunehmend modulare Weiterbildungselemente anbieten wollte. Die DGIM hat sich dagegen heftig gewehrt. Denn das würde zum Beispiel bedeuten, dass das Fachmodul Koloskopie auch von Nicht-Gastroenterologen angeboten werden dürfte.
Es kann ja nicht darum gehen, nur die Technik eines minimal-invasiven Eingriffs zu beherrschen.
Der ausführende Arzt muss zusätzlich das große Hintergrundwissen haben, um sagen zu können: "Für mich sieht das aus wie ein Morbus Crohn" oder: "Das könnte durchaus eine seltene Infektion sein."
Braucht es nicht dennoch eine flexiblere Variante der Fort- und Weiterbildung, die auf neue Anforderungen in der Medizin eine Antwort bietet?
Ja, natürlich. Im Moment steht ja eine große Novelle der Weiterbildungsordnung an. Die derzeit laufende inhaltliche Gestaltung einer kompetenzbasierten Novellierung der (Muster)-Weiterbildungsordnung durch die Bundesärztekammer bietet allen beteiligten ärztlichen Organisationen, also Fachgesellschaften und Berufsverbänden, die Chance, nach einem System der Kompetenzniveaus abgestimmte Vorschläge einzureichen.
Dies könnte - und dies wird auch nach meiner Auffassung - eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, nicht zu sehr in Modulen und "abzuleistenden" Katalogen zu denken.
Es wird ein größeres Gewicht gelegt werden auf Kompetenzen, die über spezielle Fähigkeiten des eigenen Schwerpunktfaches hinausgehen und den kollegialen Austausch mit benachbarten Fächern, gemeinsame Fallkonferenzen, die Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung und komplexes Denken betreffen.