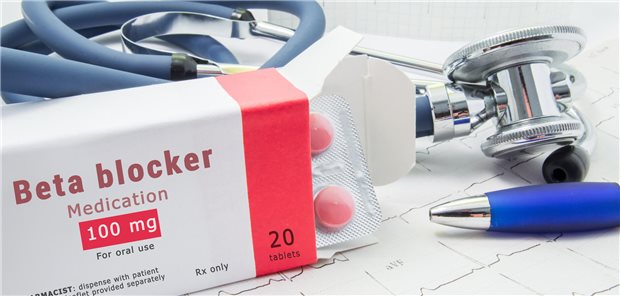Gehirn kann nach Verletzungen regenerieren
BOCHUM (eb). Nach Verletzungen können geschädigte Hirnbereiche wieder regenerieren. Innerhalb eines Jahres kann es zu neuen Zellverbindungen kommen. Forscher aus Bochum haben nun detaillierte Daten über die Aktivität von Nervenzellen der Sehrinde von erwachsenen Katzen veröffentlicht.
Veröffentlicht:Dr. Dimitrios Giannikopoulos und sein Team haben den Zeitverlauf, das Ausmaß und die Möglichkeiten neuer Zellverbindungen des Gehirns nach einer Verletzung untersucht (PNAS, online vorab).
Zunächst wurde eine definierte Stelle der Netzhaut von Katzen geschädigt. Innerhalb von Wochen bis zu einem Jahr kam es zur Umorganisation der Sehrinde. Betroffene Bereiche wurden neu verbunden und wieder aktiviert. "Neue Zellverbindungen wandern ähnlich einer Welle langsam über Wochen vom gesunden Randbereich in die geschädigte Region" sagte Giannikopoulos.
Dabei seien die Zellen vorübergehend in ihren Eigenschaften Zellen nach der Geburt ähnlich. Ungeschädigte Zellen verbänden sich zunächst mit denen im geschädigten Areal. Je nach Entfernung zwischen gesundem und geschädigtem Gebiet könnten zehn bis 100 Prozent der Zellen beteiligt sein. Nach Abschluß des Prozesses normalisiert sich die Funktion der Zellen - mit teils abgeschwächter Leistung.