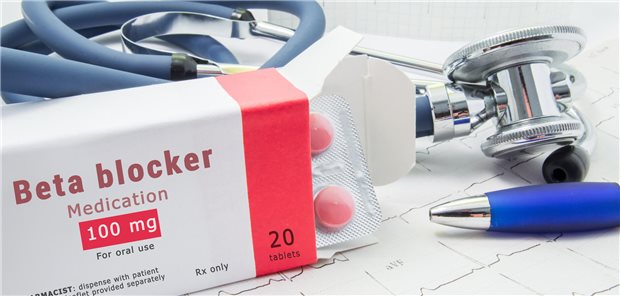Viele dicke Deutsche leben in Thüringen
FRANKFURT/MAIN (Smi). Viele dicke Deutsche leben in Ostdeutschland, speziell in Thüringen. In den Städten sind die Bürger im Durchschnitt zwar schlanker als auf dem Land, aber auch sie bringen mehr auf die Waage, als es für ihre Gesundheit gut ist.
Das sind Ergebnisse einer Untersuchung, die die Stuttgarter Forschungsgruppe Biometrie und Ergometrie des Instituts für Rationelle Psychologie im Auftrag des Zeitschriftenmagazins "Men's Health" angestrengt hat.
Für ihre Studie haben die Forscher 19 768 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren untersucht. Ermittelt wurden der Body-Mass-Index (BMI), der Bauchumfang und die Verteilung des Körperfetts.
Der mittlere Bauchumfang eines Mannes beträgt in Thüringen 98,27 Zentimeter, in Mecklenburg-Vorpommern 98,10 und in Sachsen-Anhalt 97,95 Zentimeter. Das ist Spitze in Deutschland. Zum Vergleich: In Hamburg misst der Bauchumfang der Männer durchschnittlich 94,81 Zentimeter, in Bremen 95,04 und in Berlin 95,23 Zentimeter. Dabei ist die Gesundheit der Städter ebenfalls gefährdet, da schon bei Werten ab 94 Zentimetern die Gefahr von Infarkten und Diabetes deutlich erhöht ist.
Ein ähnliches Ergebnis wie bei den Männern zeigt sich bei den Frauen. Auch hier sind die Thüringerinnen (87,10), die Sachsen-Anhalterinnen (86,97) und die Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern (86,83) die dicksten und die Frauen aus Stadtstaaten wie Hamburg (83,63), Bremen (83,77) und Berlin (83,89) etwas schlanker. Bei Frauen erhöht sich das gesundheitliche Risiko ab Werten von 80 Zentimetern.
Dass es auf dem Land noch mehr Dicke gibt als in der Stadt, erklärt der Präventionsmediziner Professor Herbert Schuster aus Berlin unter anderem damit, dass in Städten mehr (figurbewusste) Singles leben und Städter im Allgemeinen innovativer seien als Landbewohner, was sich sowohl auf die Sport- als auch auf die Ernährungsgewohnheiten auswirke. Viele Ostdeutsche litten zudem unter den Spätfolgen der DDR-Planwirtschaft, in der statt Obst und Gemüse eher Fleisch und Sättigungsbeilagen als empfehlenswerte Nahrung propagiert worden sei.