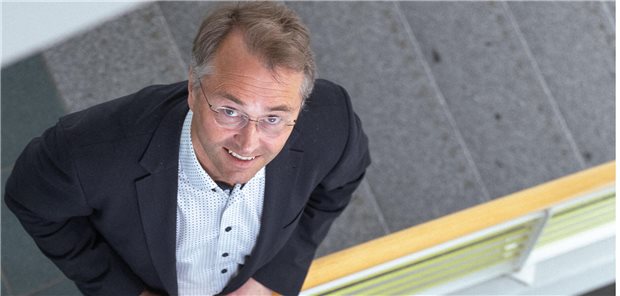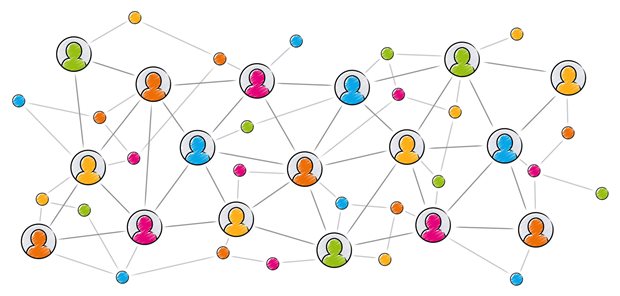Geplante Patientenrechte sorgen für lange Gesichter
Schlechte Noten für das Patientenrechtegesetz: Der vom Kabinett verabschiedete Entwurf gilt als kleinster gemeinsamer Nenner. Länder, Kassen und Opposition nörgeln, haben aber auch Ideen, wie der Entwurf in ihren Augen noch gerettet werden kann.
Veröffentlicht:
Eine Schwester zählt Op-Besteck nach. Im Körper von Patienten vergessene Instrumente zählen zu den Fehlern, die immer wieder auftreten.
© Berg / dpa
BERLIN/NÜRNBERG (di/sun/af/HL). Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ist unzufrieden mit dem Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Patientenrechte. Sie will nun gemeinsam mit anderen Ländern weiter Druck machen für ein "Patientenrechtegesetz, das diesen Namen verdient"."
Nach ihrer Ansicht bleibt der Entwurf "weit hinter dem Notwendigen zurück". Vor allem vermisst sie einen Härtefallfonds, mit dem Opfern von Behandlungsfehlern unbürokratisch geholfen werden könnte. Den fordern auch die Vertreter von neun weiteren Ländern nach wie vor.
Geschädigte Patienten hätten bisher große Probleme, wenn sie Entschädigungsansprüche durchsetzen wollten, sagte Nordrein-Westfalens Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) nachdem die Bundesministerrunde den Gesetzentwurf abgenickt hatte.
"Patientenbrief" soll ins Gesetz
Patientenrechtegesetz im Überblick
Der Entwurf des Patientenrechtegesetz sieht keine generelle Beweislastumkehr vor.
Der Behandlungsvertrag soll im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert werden.
Ärzte müssen Patienten persönlich über eine Behandlung und ihre Risiken aufklären.
Patienten sollen ein Einsichtsrecht in ihre Akte erhalten.
Kassen sollen verpflichtet werden, ihren Mitgliedern bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen zu helfen.
Entscheidungen von Kassen über Anträge auf Leistungen werden an Fristen gebunden.
Wie ihre Hamburger Kollegin versucht Steffens weiterhin den "Patientenbrief" im Gesetz unterzubringen. Der solle analog zum Arztbrief den Patienten in leicht verständlicher Sprache Diagnose und Therapie erklären.
Dies wäre ein entscheidender Beitrag, um Missverständnisse zwischen Ärzten und Patienten zu vermeiden und die Compliance zu verbessern.
In getrennten Pressemitteilungen fordern die beiden Ressortchefinnen, die individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) strenger gesetzlich zu regeln. "Auch hinsichtlich der privat zu zahlenden Zusatzleistungen (IGeL) hat sich das Kabinett inhaltlich nicht bewegt.
Ein Schutz von Patienten vor unnötigen, aber teuren Behandlungen wird nicht geleistet und scheint auch von der Bundesregierung nicht gewollt zu sein", kritisierte Prüfer-Storcks. Die Vorschläge der Länder zu Akquise, Beratung und Vertragsgestaltung der IGeL-Leistungen greife der Gesetzentwurf gar nicht auf, heißt es bei Steffens.
Ärztetag mit dem Entwurf unzufrieden
Auch bei den Delegierten des 115. Deutschen Ärztetags in Nürnberg stieß der Gesetzentwurf nur auf wenig Gegenliebe. Das Problem ist der darin geplante Paragraf 630e des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Danach muss die Aufklärung eines Patienten vor einem invasiven Eingriff durch den behandelnden Arzt erfolgen. Diese Vorschrift kollidiert mit den hoch arbeitsteiligen Prozessen der Hochleistungsmedizin und der Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen vor allem auch für Ärztinnen in Kliniken zu flexibilisieren.
Die Bundesärztekammer hat dies bereits mit den politischen Gremien in Berlin thematisiert und dafür jetzt auch Rückendeckung vom Deutschen Ärztetag erhalten.
Seine Argumentation: Die geplante Gesetzesregelung erschwert die Realisierung von Teilzeitarbeit. Das wäre kontraproduktiv für die angestrebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Patienten würden häufig lange Zeit vor einem geplanten Eingriff aufgeklärt. Zu diesem Zeitpunkt stehe oft noch gar nicht fest, welcher Arzt konkret den Eingriff vornehmen wird.
Ein besonderes Problem entsteht für Anästhesistinnen: Sie dürfen - wegen mutmaßlich schädlicher Narkosegase - in der Schwangerschaft nicht mehr im Op eingesetzt werden.
Gleichwohl seien diese Ärztinnen qualifiziert, die Patientenaufklärung zu übernehmen. Der Wortlaut des Gesetzes schließe dies jedoch aus.
Werden Patienten im Notdienst aufgenommen und dann unmittelbar von Ärzten über eine notwendige Op aufgeklärt, dann entstehe ein Konflikt, wenn notwendigerweise ein anderer Arzt am Folgetag den Eingriff übernehme.
Ferner komme es zu einer Verengung der Arbeitskapazitäten, wenn nur der Eingriff durch einen erfahrenen Arzt vorgenommen werden muss, dieser Arzt aber auch die Aufklärung übernehmen müsse.
Letzteres könne durchaus auch ein Arzt in Weiterbildung. Hinderlich seien auch die umfassenden Dokumentationsverpflichtungen.
Bayern will Entschädigungsfonds
Auch Bayern dringt auf Änderungen. Gesundheitsminister Dr. Marcel Huber (CSU) will im Gesetzgebungsverfahren einen Entschädigungsfonds erreichen.
Aus dem sollten Opfer von Behandlungsfehlern geholfen werden kann, wenn dem behandelnden Arzt der Fehler nicht letztgültig nachgewiesen ist. Bereits Bayerns Patientenbeauftragte Dr. Gabriele Hartl hatte sich im Dezember für diese Fondslösung ausgesprochen.
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) lehnt so einen Fonds strikt ab. Er hatte gesagt, dass ein Entschädigungsfonds der Rechtssystematik widerspreche. "Die Solidargemeinschaft darf nicht herangezogen werden, wenn ein Arzt einen Schaden verursacht hat." Zudem bräuchte ein Fonds ein eigenes Antragsverfahren und mehr Bürokratie.
Kassen unzufrieden
Kritik kam auch von den Kassen. Der geschäftsführende AOK-Vorstand Uwe Deh mahnte Verbesserungen beim Schutz vor überflüssigen Behandlungen an.
Die Patienten könnten damit nicht zufrieden sein. Die politischen Akteure hätten sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, so Deh weiter.
Weitere Aspekte nahm die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Katrin Vogler (Linke) in den Blick. Eine Herstellerhaftung zur Absicherung von Geschädigten wie beim Brustimplantate-Skandal sehe der Entwurf nicht vor.
Er treffe ferner keine Regelungen für barrierefreie Zugänge zur medizinischen Versorgung im Sinne der UN-Behindertenkonvention.
Kontrovers diskutiert wird nach wie vor auch die Beweislastumkehr, die Patientenschützer gerne weiter gefasst gesehen hätten.
Eine generelle Umkehr der Beweislast belaste das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, sagte Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Letztlich führe sie zu einer Kultur der Risikovermeidung.