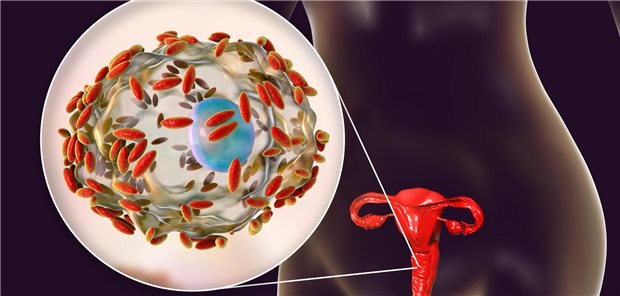Interview zur personalisierten Krebstherapie
Lungenkrebs: Wie Zentren wohnortnah versorgen können
Werden Lungenkrebs-Patienten in spezialisierten Zentren behandelt, steigt ihre Überlebensrate signifikant. Dennoch hat ein Drittel der Patienten keinen Zugang zu dieser Möglichkeit. Der Onkologe Professor Jürgen Wolf über Treibermutationen und das Geschwür der Bürokratie.
Veröffentlicht:
Patientengespräch in der Praxis. Die eigentliche Therapie muss nicht zwangsläufig in den Onkologie-Zentren stattfinden. Die Mehrzahl der Lungenkrebs-Patienten will wohnortnah betreut werden, dies ist auch bei den regionalen Netzwerkpartnern in hoher Qualität möglich, so Prof. Jürgen Wolf, Leiter des Centrums für Integrierte Onkologie. (Motiv mit Fotomodellen)
© rocketclips / stock.adobe.com
Herr Professor Wolf, eine Evaluationsstudie von Wissenschaftlern der Uniklinik Köln und der Unimedizin Greifswald hat Überlebensraten von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verglichen. Was haben Sie und Ihre Kollegen herausgefunden?
Patienten, die innerhalb des Nationalen Netzwerks Genomische Medizin (nNGM) behandelt wurden, leben länger als Patienten, die vom Netzwerk nicht erfasst wurden. Der Unterschied beträgt etwa zwei Monate im Median für die gesamte Kohorte und ist statistisch signifikant. Der Effekt kommt in erster Linie durch eine erhöhte Testrate im Netzwerk zustande, daraus resultiert eine höhere Rate an zielgerichteten Behandlungen. Für die zielgerichtet behandelten Patienten ist der Überlebensunterschied natürlich größer. Bei diesen Betroffenen leben nach einem Jahr noch 67 Prozent, bei nicht zielgerichtet behandelten nur 40 Prozent.
Woraus resultiert dieser Unterschied?
Im Netzwerk wird mehr getestet und in der Folge mehr zielgerichtet behandelt. Auch die Immuntherapie wurde im untersuchten Zeitraum häufiger eingesetzt, was zusätzlich einen schnelleren Innovationstransfer im Netzwerk unterstreicht.
Zunächst zur Diagnostik. Wie funktioniert die Methode?
Mittels neuer Genomsequenzierungsverfahren, sogenanntes Next Generation Sequencing (NGS), können in einem Untersuchungsgang alle für das Wachstum des Tumors erforderlichen und therapeutisch angehbaren genomischen Veränderungen in einer Tumorzelle, sogenannte Treibermutationen, diagnostiziert werden. Diese Methoden können an kleinen Gewebeproben, beispielsweise im Rahmen einer Bronchoskopie oder CT-gesteuerten Biopsie, entnommen werden.
Was bewirken die Treibermutationen im Körper?
Treibermutationen sind genetische Veränderungen im Genom der Tumorzelle, die für das maligne Wachstum der Tumorzelle, also für Teilung, Metastasierung, Verhinderung von programmiertem Zelltod, Tumorgefäßversorgung etc., verantwortlich sind. Nicht mutiert, kodieren diese Gene für Proteine, oftmals Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die in physiologische Abläufe involviert sind. Erst die Mutation führt zu einer dauerhaften und damit onkogenen Aktivierung.
Thema Therapie: Was können Sie tun, wenn die Treibermutation identifiziert ist?
Dazu ein Beispiel: Bei etwa zehn Prozent aller Lungenkrebs-Patienten in westlichen Staaten ist eine epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor-Mutation Ursache für die Tumorausbreitung. Diese EGFRezeptormutationen gehören zur Gruppe der Tyrosinkinasen – das sind eben jene Enzyme, die extrazelluläre Signale über die Zellmembran ins Zellinnere übertragen. Wenn wir mit Hilfe von Medikamenten, sogenannten Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI), diese Signalübertragung unterbinden, können wir das Krebswachstum stoppen und in den meisten Fällen den Tumor zur Schrumpfung bringen.
Das heißt, der Patient ist geheilt?
Nein, geheilt ist er nicht. Aber Betroffene können oft jahrelang mit dieser dann chronischen Erkrankung leben. Zumal eine Therapie mit TKI nicht so aggressiv wirkt wie eine Chemotherapie, bei der man normalerweise sehr eingeschränkt ist, unter Nebenwirkungen leidet und oftmals nicht arbeiten kann. Voraussetzung ist allerdings, dass Ärzte die entsprechende spezifische molekulare Veränderung – eben die Treibermutation – diagnostizieren.
Wie verändern sich die Überlebensraten mit einer TKI-Therapie?
Mit einer konventionellen Chemotherapie beträgt das mediane Überleben ein Jahr, mit einer Chemoimmuntherapie sind es knapp zwei Jahre und bei TKI-behandelten Patienten können es viele Jahre sein, abhängig von der Mutation. Wir haben Patienten, die schon zehn Jahre mit metastasiertem Lungenkrebs leben, und das mit hoher Lebensqualität.
Wie hoch ist die Rückfallquote?
Alle Patienten erleiden ein Rezidiv, nur den Zeitpunkt kann man nicht vorhersagen. Im Rezidiv biopsieren wir in der Regel erneut und wiederholen die molekulare Untersuchung zur Diagnostik von Resistenzmutationen. In diesen Fällen kann oft ein neues zielgerichtetes Medikament wirken. Zunehmend erhalten Patienten im Laufe ihrer Erkrankung mehrere dieser zielgerichteten Medikamente.
Einige dieser Therapien sind bereits zugelassen, andere Behandlungen können im Rahmen klinischer Studien erfolgen. Welche Kriterien müssen Patienten erfüllen, um daran teilzunehmen?
Jede Studie hat eigens definierte Einschlusskriterien. Zu den Parametern zählen beispielsweise: die Zahl und Art der Vortherapien, das Vorhandensein von Hirnmetastasen, Herzfunktion und Nierenfunktion.
Manche Treibermutationen betreffen einen sehr kleinen Patientenkreis. Unter bestimmten Ausprägungen leidet nur ein Prozent der Lungenkrebs-Erkrankten, bei anderen Varianten sind es drei oder fünf Prozent. Welche Aussagekraft haben Studien mit so geringer Teilnehmerzahl?
Wenn die Studien erfolgreich durchgeführt werden, haben sie die gleiche Aussagekraft wie andere Studien auch. Das Problem ist, dass die Durchführung von Studien in so seltenen Subgruppen eine große logistische Herausforderung darstellt und nicht immer möglich ist. Auch ändert sich im Angesicht der dynamischen Entwicklung oftmals der Standardarm während der Studie. Und zunehmend lehnen Patienten solche Studien ab, weil sie auf jeden Fall mit dem neuen Medikament behandelt werden wollen.
Bislang werden nur etwa zwei Drittel der infrage kommenden Patienten molekular getestet und personalisiert behandelt. Warum wird das übrige Drittel nicht erreicht?
Das hat viele Gründe. Einerseits ist die Versorgung in Deutschland extrem dezentral organisiert. Wir haben hierzulande etwa 1.800 Kliniken und mehr als 600 onkologische oder hämatologische Praxen – und grundsätzlich dürfen alle Krebspatienten behandeln. Hinzu kommt, dass sich die Erkenntnisse bezüglich der personalisierten Therapie extrem schnell verändern. Alle drei, vier Monate entdecken Wissenschaftler eine neue Treiber-Mutation oder entwickeln ein neues Medikament. Dieses Wissen zügig auch in kleine Krankenhäuser oder Praxen zu transferieren, ist schwierig.
Wie ließe sich das Dilemma lösen?
Unser Ansatz als Nationales Netzwerk Genomische Medizin ist eine intelligente Arbeitsteilung zwischen den mittlerweile 18 spezialisierten Zentren und den derzeit rund 480 Versorgern in der Fläche – etwa die eine Hälfte Kliniken, die andere Praxen. In den nNGM-Zentren erfolgt die Diagnostik und die Interpretation der Befunde. Außerdem geben wir Behandlungsempfehlungen. Später übernehmen wir die Evaluation. Die eigentliche Therapie muss nicht zwangsläufig in den Zentren stattfinden. Die Mehrzahl der Lungenkrebs-Patienten will wohnortnah betreut werden, und dies ist auch bei den regionalen Netzwerkpartnern in hoher Qualität möglich.
Molekulare Diagnostik kann auch durch private Laborketten oder Pharmafirmen erfolgen. Warum sollten Praxen mit dem nNGM kooperieren?
Wir glauben, dass Diagnostik, Therapieempfehlungen, Beratung und Evaluation in einer Hand liegen sollten. Ich treffe in meiner Zweitmeinungssprechstunde viele Patienten, die einen kommerziellen Test genutzt und sehr viel dafür gezahlt haben. Und die sitzen dann ratlos vor mir mit einem 30-Seiten-Befund, dessen therapeutische Konsequenzen sich weder ihnen noch ihren behandelnden Onkologen erschließt. Ich denke, dass auch eine zentrale Datensammlung, gerade bei seltenen Subgruppen, notwendig ist und in akademischen Zentren frei zugänglich für die wissenschaftliche Community sein soll.
Wie unterstützen Sie die niedergelassenen Onkologen?
Viele Praxisbetreiber klagen über Überlastung. Durch eine Zusammenarbeit mit den nNGM sparen sie Zeit. Sie liefern uns die Gewebeproben und wir übernehmen anschließend nicht nur Diagnostik und Therapieempfehlungen, sondern bieten zusätzliche Beratungen an. Wir haben zum Beispiel molekulare Tumorboards, in denen interdisziplinäre Teams spezielle Fälle besprechen. Erkrankte können in einem der Zentren eine Zweitmeinungssprechstunde besuchen, in der wir noch mal alle Optionen erklären.
Was kostet das die Patienten?
Die Diagnostik ist für Mitglieder von Krankenkassen, mit denen wir zusammenarbeiten, kostenlos. Übrigens ist es weltweit einmalig, dass gesetzliche Krankenkassen diese Ausgaben in diesem Umfang übernehmen.
Die Organisation des Netzwerks, etwa Management und Koordination, verursacht ebenfalls Kosten. Wie finanzieren sie diese Posten?
Bislang unterstützt uns die Deutsche Krebshilfe. Die Förderung läuft noch maximal bis 2027. Wir wünschen uns von der Politik und den Krankenkassen Unterstützung, um das nNGM auch danach am Leben zu erhalten. Gerade jetzt, wo der Überlebensvorteil für die Patienten nachgewiesen ist.
Der Ursprung des nNGM liegt der Uniklinik Köln, an der Sie als Onkologe praktizieren. Was war die Motivation für die Gründung des Netzwerks?
Uns ging es von Anfang darum, diesen früher nicht für möglich gehaltenen Therapiefortschritt durch die personalisierte Therapie möglichst vielen Patienten zukommen zu lassen, nicht nur denen, die sich in die Uniklinik verirren. Und wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass dies in Deutschland nur mit kooperativen Netzwerkstrukturen möglich ist.
Um Krankheitsverläufe effektiv zu dokumentieren und zu analysieren, sollten Patientendaten in elektronischer Form vorliegen. Wie beurteilen Sie den Stand der Digitalisierung in Ihrem Fachgebiet?
Die Probleme betreffen einmal die IT selbst, die Heterogenität der Systeme, die fehlenden Schnittstellen, keine einheitlichen Vorgaben für Datenformate. Hier fehlt der politische Wille, Digitalisierung im Gesundheitssystem ernsthaft voranzutreiben, wie in anderen Ländern auch. Dazu kommt eine überbordende Datenschutzbürokratie. Alleine für die Erlaubnis zur molekularen Diagnostik und zur wissenschaftlichen Nutzung pseudonymisierter Daten haben wir 18 Monate benötigt. Wir mussten Ethikvoten von mehr als 30 Ethikkommissionen einholen, die alle wiederum ihre Datenschutzbeauftragten konsultiert haben. In Deutschland gibt es sogar Diözesandatenschutzbeauftragte! In dieser Zeit sind Tausende von Patienten früher gestorben, einfach weil sie nicht getestet wurden.
Patientendaten sind sehr sensible Daten …
… das ist richtig und wir sind unbedingt für Datenschutz. Aber das Problem ist ja nicht der Datenschutz, sondern die Datenschutz-Bürokratie. Der Umgang mit Patientendaten wird ja nicht geschützter, wenn 30 Ethikkommissionen und 50 Datenschutzbeauftragte in Genehmigungsprozesse involviert sind.
Was wäre Ihr Wunsch?
Ein zentralisiertes Genehmigungsverfahren mit einer Institution, zum Beispiel in Berlin, mit der Möglichkeit der digitalen Einreichung von Anträgen. Ohne eine konsequente Zentralisierung in diesem Bereich und eine Digitalisierung der Verfahren werden wir der Bürokratie nicht mehr Herr, zum Schaden der Patienten und zum Nachteil der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Forschung.
Wie viel Patientendaten haben Sie bislang in der nNGM-Datenbank?
Von etwa 28.000 Patienten. Die zentrale Datenbank aufzubauen mit der Integration molekularer und klinischer Daten war eine große Herausforderung. Jetzt wächst der Datenpool kontinuierlich und ich denke, wir werden bald die doppelte Zahl an Datensätzen haben. Insgesamt diagnostizieren wir im Netzwerk jährlich rund 17.000 Patienten. Schon jetzt publizieren wir regelmäßig auf international hohem Niveau Real World Daten zum Therapie-abhängigen Outcome in molekularen Subgruppen.
Funktionieren molekulare Diagnostik und personalisierte Therapie nur bei Lungenkrebs oder auch bei anderen Krebsarten?
Treibermutationen werden auch bei anderen Tumorarten gefunden, allerdings, aus bisher unbekannten Gründen, in geringerer Anzahl. Dennoch ermöglichen sie bei den betreffenden Patienten Alternativen zu den oft wenig wirksamen Standardtherapien. Perspektivisch sollten daher alle Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung molekular typisiert werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Prof. Jürgen Wolf ist Leiter des „Centrums für Integrierte Onkologie“ (CIO) der Uniklinik Köln und Sprecher des „Nationalen Netzwerks Genomische Medizin“ (nNGM).