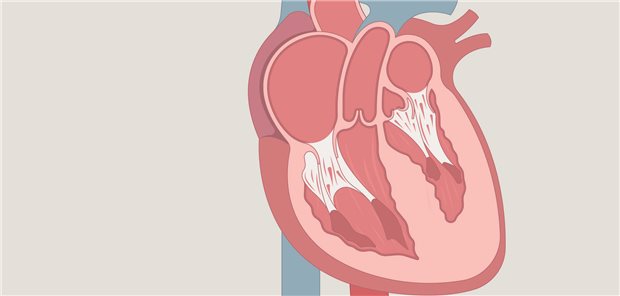Krebs
Nur wenige zusätzliche Zentren für flächendeckende Versorgung nötig
Die meisten Patienten mit Brust- oder Darmkrebs finden schon jetzt ein zertifiziertes Behandlungszentrum in ihrer Nähe. Das zeigt der Krankenhaus-Report 2015.
Veröffentlicht:BERLIN. Um eine flächendeckende Versorgung von Krebspatienten in zertifizierten Behandlungszentren mit guter Behandlungsqualität und hohen Fallzahlen zu erreichen, wären nur wenige zusätzliche Zentren nötig. Das zeigt eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die im Krankenhaus-Report 2015 veröffentlicht worden ist.
Die meisten Patienten mit Brustkrebs und Darmkrebs finden danach schon jetzt in der Nähe ihres Wohnortes eine von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Klinik.
Auf Basis von Abrechnungsdaten der AOK zeigt sich, dass im Jahr 2013 insgesamt 783 Krankenhäuser Brustkrebs-Op durchgeführt haben. Von diesen waren 42 Prozent (326 Kliniken) durch die Deutsche Krebsgesellschaft oder durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert.
Die durchschnittliche Fallzahl dieser Anbieter lag mit 62 AOK-Patientinnen höher als bei Krankenhäusern ohne Zertifikat, die im Durchschnitt nur 12 AOK-Patientinnen mit einem Mammakarzinom behandelten.
"Insgesamt werden bei Brustkrebs heute bereits 79 Prozent der AOK-Patientinnen an zertifizierten Zentren operiert", sagt Jörg Friedrich, Forschungsbereichsleiter Krankenhaus im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO).
Knackpunkt Mindestmenge
Für die Zertifizierung als Brustkrebszentrum muss eine Klinik unter anderem eine Mindestmenge von 50 Eingriffen pro Operateur gewährleisten. In einem Großteil der Nicht-Zentren liege die erreichte Fallzahl jedoch weit darunter, erklärt Friedrich: "Bei einem durchschnittlichen AOK-Marktanteil von ca. 30 Prozent operierten im Jahr 2013 zwar 92 Häuser mehr als 20 AOK-Fälle, 114 Einrichtungen aber maximal zwei AOK-Fälle."
Von den 457 Nicht-Zentren, die 2013 AOK-Patientinnen operiert haben, würden vermutlich längst nicht alle die Zertifizierungsverfahren der Krebsgesellschaft erfolgreich durchlaufen.
Wenn sämtliche Patientinnen in den vorhandenen Zentren behandelt werden sollten, würde sich der durchschnittliche Anfahrtsweg je Postleitzahlengebiet nach der WIdO-Auswertung lediglich von 14 auf 22 Kilometer erhöhen. Nur in fünf Prozent der Postleitzahlenbereiche in Deutschland würde es danach Fahrtwege über 50 Kilometer geben.
Um auch diese Gebiete mit einem zertifizierten Brustkrebszentrum innerhalb von 50 Kilometern zu versorgen, wären nach Berechnungen des WIdO nur 68 zusätzliche Standorte notwendig. "Wir sind also von einer flächendeckenden Versorgung gar nicht so weit entfernt", so Friedrich.
Etwas anders, wenn auch mit ähnlichen Schlussfolgerungen, stellt sich die Situation für die Indikation Darmkrebs dar. Hier waren 2013 etwa ein Viertel der 1031 Krankenhäuser, die mit der AOK abrechneten, zertifiziert. Diese Zentren operierten 44 Prozent der AOK-Patienten. Jedes Zentrum behandelte im Mittel 40 AOK-Fälle.
In den Nicht-Zentren waren es demgegenüber nur durchschnittlich 18 Fälle. "Auch hier zeigt sich, dass in den Nicht-Zentren zum Teil sehr kleine Fallzahlen versorgt werden", erläutert Friedrich. Die Zertifizierung sei beim Darmkrebs noch nicht so weit verbreitet wie beim Brustkrebs.
Deshalb hätte ein Wegfall der Nicht-Zentren für diese Indikation nach der WIdO-Auswertung etwas größere Auswirkungen auf die flächendeckende Versorgung: Der nächste Leistungserbringer je Postleitzahlgebiet wäre dann durchschnittlich in 26 Kilometern statt in 12 Kilometern erreichbar.
Damit in allen Postleitzahlgebieten ein Darmkrebszentrum in maximal 50 Kilometer Entfernung erreichbar wäre, würden bei dieser Indikation 116 zusätzliche zertifizierte Standorte benötigt.
Längerer Fahrtweg kein Problem
Die Analyse des WIdO zeigt zudem, dass Patientinnen und Patienten durchaus bereit sind, für Kriterien wie nachgewiesene Qualität weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. So ließen sich 63 Prozent der AOK-Patientinnen eines Zentrums in der Indikation Brustkrebs dort behandeln, obwohl andere Leistungserbringer näher gewesen wären. Bei Darmkrebs waren es 55 Prozent.
"Zertifizierte Zentren mit Qualitätsvorteilen und hohen Fallzahlen übernehmen schon heute einen großen Teil der Versorgung - beim Brustkrebs mehr, beim Darmkrebs bislang noch weniger", lautet das Fazit von Friedrich. In Nicht-Zentren würden dagegen häufig sehr viel weniger Fälle behandelt.
Eine Beschränkung der Behandlung in der Indikation Brustkrebs auf die bestehenden zertifizierten Zentren würde nur für kleinere Gruppen von Patientinnen zu relevanten Fahrzeitverlängerungen führen.
Friedrich: "Bei einer politischen Entscheidung für mehr Konzentration ist dieser Nachteil gegen den Qualitätsvorteil der Zentrumsbehandlung abzuwägen - gerade auch bei den hier betrachteten relevanten onkologischen Indikationen."
In der Praxis dürfte sich die Bedeutung der Erreichbarkeitsfrage in Zukunft von selbst etwas abschwächen, denn es lassen sich kontinuierlich weitere Leistungserbringer zertifizieren.
"Die zertifizierten Brustkrebszentren können als Blaupause für eine qualitätsorientierte Zentralisierung der stationären Versorgung dienen. Mit einem sinnvollen politischen Fahrplan und zusätzlichen Zentren dürften sich regionale Versorgungsengpässe gut meistern lassen", so die Prognose von Jörg Friedrich.
Hausarztpraxen sind erster Ansprechpartner
Hausärzte sind bei der Behandlung von Krebspatienten eine wichtige Schnittstelle zwischen Klinik und ambulanter Versorgung. Dr. Simone Wesselmann von der Deutschen Krebsgesellschaft erklärt, wie sie diese Aufgabe meistern.
Ärzte Zeitung: Welche Rolle spielen niedergelassene Ärzte in der Versorgung von Krebspatienten?
Dr. Simone Wesselmann: Die niedergelassenen Ärzte und speziell die Hausärzte sind eine extrem wichtige Schnittstelle. Der Verdacht auf eine Tumorerkrankung wird häufig in der Ambulanz festgestellt. Und im späteren Verlauf der Behandlung und der Nachsorge kommen die Patienten mit Fragen zu allen Bereichen zu ihrem vertrauten Hausarzt. Dann ist es wichtig, jedem Patienten zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung die richtigen Infos zu geben. Das ist eine regelrechte Herkulesaufgabe.
Auf welche Fragen müssen sich die Hausärzte denn einstellen?
Das ist ein breites Themenspektrum und geht deutlich über die Medizin hinaus. Sicher wollen Patienten zum Beispiel Fragen zu Nebenwirkungen von Therapien oder zur Komplementärmedizin geklärt haben, zur richtigen Ernährung bei Krebs oder zu Sportmöglichkeiten. Viele suchen aber auch Rat zu Möglichkeiten der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben bei ihrem Arzt.
Das wissen wir aus Befragungen. Welcher Sozialarbeiter kann mir weiterhelfen, wo finde ich eine Selbsthilfegruppe oder wo werde ich gut psychoonkologisch betreut? All das sind Fragen, mit denen sich Patienten an Hausärzte wenden.
Wie können die Patienten mit ihren Anliegen dann aufgefangen werden?
Am besten, indem alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten Hand in Hand arbeiten. Es sind eben besondere Behandlungs- und Kommunikationsstrategien nötig. Deshalb setzen wir, also die Deutsche Krebsgesellschaft, auf zertifizierte Netzwerke. Onkologische Patienten können nicht ausschließlich durch den einen Facharzt oder die eine Behandlungsgruppe behandelt werden.
Es wird das aktuelle Wissen vieler Behandlungspartner benötigt, um alle Phasen und Bereiche der Erkrankung abzubilden. Zertifizierung bedeutet immer Netzwerkzertifizierung. Hausärzte oder andere niedergelassene Ärzte, die nicht selber Mitglied an einem zertifizierten Netzwerk sind, können sich an dem Zertifikat orientieren und ihre Patienten in den Sprechstunden oder Tumorkonferenzen vorstellen.
Nach welchen Kriterien zertifiziert die DKG?
Die Anforderungen werden von Zertifizierungskommissionen entwickelt, in denen Fachgesellschaften, Berufsverbände, Arbeitsgemeinschaften und Patientenorganisationen zusammenarbeiten. Sie definieren Qualitätsindikatoren, die sich aus aktuellen medizinischen Leitlinien ableiten. Dazu kommen Kennzahlen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
Fachexperten überprüfen in einem Audit die Umsetzung der Anforderungen vor Ort. Sollten Abweichungen festgestellt werden, müssen diese von den Zentren begründet werden. Ob ein Zertifikat erteilt wird, entscheidet ein Ausschuss auf der Grundlage der Informationen der Zentren und der Audit-Dokumentation.
In jährlichen Berichten werden dann die Ergebnisse der Kennzahlenauswertung anonymisiert zusammengefasst.
Wie können die Zentren die Ergebnisse nutzen?
Die Auswertung gibt einen Überblick über den Qualitätsstandard im allgemeinen und macht es den Zentren außerdem möglich, eigene Leistungen einzuordnen und gegebenenfalls zu verbessern. Das hat sich bewährt. Denn die Sollvorgaben werden in der Regel erreicht und sogar überschritten.
Wenn Abweichungen von der Sollvorgabe auftreten, müssen diese begründet werden. Damit lässt sich gut nachvollziehen, warum Therapien nicht durchgeführt wurden, zum Beispiel weil Begleiterkrankungen vorlagen oder die Patienten sich nach Aufklärung gegen eine bestimmte Therapie entschieden haben.
Und wo finden niedergelassene Ärzte die für sie nötigen Informationen?
Zum einen natürlich über die Krebsgesellschaft. Im Internet sind zum Beispiel zertifizierte Zentren unter www.oncomap.de aufgelistet. Zum anderen informieren wir im Rahmen einer Kampagne gemeinsam mit dem Hausärzteverband und dem Institut für hausärztliche Fortbildung zu relevanten Fragen rund um die Versorgung von Tumorpatienten. (Taina Ebert-Rall)
Dr. Simone Wesselmann ist Bereichsleiterin Zertifizierung bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Die von der DKG zertifizierten Krebszentren finden Sie unter: www.oncomap.de