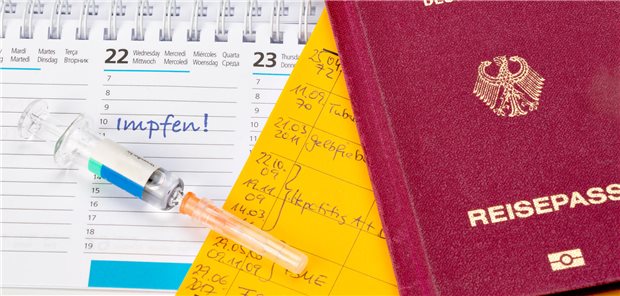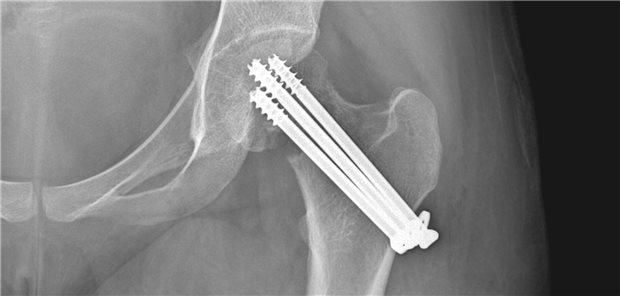Einsatz im Seniorenheim
Roboter Oskar: Nie schlecht gelaunt, für Pflegekräfte aber noch keine große Hilfe
Roboter in der Pflege werden schon getestet. Was bringen sie und sind sie den Pflegekräften in Heimen eine Hilfe? Ein Blick in ein Mannheimer Seniorenwohnheim.
Veröffentlicht:
Immerhin niedlich anzuschauen: ein sozialer Roboter im Aufenthaltsraum eines Seniorenzentrums.
© Uwe Anspach/dpa
Mannheim. Den Kopf ein wenig schief gelegt, schaut Oskar mit weit aufgerissenen Augen sehr süß und sehr kindlich aus der Wäsche. Rund 80 Zentimeter groß und gendergerecht angetan mit einer blauen Wollmütze blickt er Maria Karusseit direkt ins Gesicht. Die 74 Jahre alte Bewohnerin des Altenheimes der Evangelischen Heimstiftung in Mannheim mag Oskar.
Er ist ein sogenannter sozialer Roboter und wird schon seit Ende 2023 in dem Seniorenwohnheim erprobt. Er kennt die Musikgruppe R.E.M. und auch Johann Sebastian Bach. Karusseit erzählt ihm davon, wie sie einst Bingo spielte und von ihrem Ruf als Glücksfee. Manchmal spricht sie mit ihm über Tierdokus, sagt sie. Oskar kann Blickkontakt aufnehmen, geduldig zuhören, Fragen beantworten. Und vor allem stellt er sehr viele Fragen.
Mehrere soziale Roboter schon bundesweit im Einsatz
„Das motiviert die Bewohner, die mit ihm interagieren“, sagt Ralf Bastian, Leiter der Mannheimer Einrichtung. Oskar sei immer zugewandt, immer geduldig, nie schlecht gelaunt. „Er triggert immer positiv.“
Bundesweit sind die „Sozialroboter“ des Münchner Unternehmens Navel Robotics schon seit dem Herbst 2023 in einigen Pflegeheimen im Einsatz, im Südwesten etwa in Albershausen, einem weiteren Heim der Evangelischen Heimstiftung, und in einer Einrichtung des ASB Ludwigsburg. Laut einem Unternehmenssprecher „arbeiten“ die künstlichen Helfer in rund 15 Einrichtungen bundesweit, und sie werden im europäischen Ausland an Universitäten getestet. Kommendes Jahr soll Navel den Angaben zufolge in Serie gehen.
Wird die Würde der Heimbewohner beeinträchtigt?
Unterschieden wird generell zwischen mehreren Formen von Robotik. So gibt es sogenannte Serviceroboter, die etwa Pflegeutensilien oder Schmutzwäsche durch die Gegend fahren können. Manche sind auch in der Lage, dem Personal Bescheid zu geben, wenn sie nachts auf Patrouillenfahren einem umherirrenden Patienten begegnen, schreibt das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Dann gibt es robotische Systeme, die bei der Hebearbeit helfen können. Und eben soziale Roboter wie Oskar.
Ob soziale Roboter aber tatsächlich dazu beitragen können, angesichts dramatischen Fachkräftemangels und absehbar immer mehr alten Menschen die drängenden Probleme in der Pflege zu lindern, ist durchaus umstritten. Es gebe zahlreiche ethisch-moralische Fragestellungen wie Kontaktverlust, Täuschung, Würde, Privatsphäre oder Datenschutz, die noch nicht geklärt seien, sagt ein Sprecher des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg.
Patientenschützer zwiegespalten
Die Stiftung Patientenschutz hat ebenfalls kein allzu gutes Gefühl dabei. „Beim Wort Roboter zucke ich zusammen“, sagt Vorstand Eugen Brysch. „Dass ein Roboter die Pflege am Menschen übernehmen kann, das glaube ich nicht.“ Zwar sieht er einen Unterschied zwischen sozialen Robotern wie denen von Navel und solchen, die in eher ferner Zukunft tatsächlich physisch bei körperlichen Pflegeleistungen am Patienten helfen könnten. Aber: „Das ist ein schwerer Eingriff in die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Den Körperkontakt kann der Roboter nicht ersetzen.“
Letzterem stimmt auch die Leiterin der Abteilung Alltagsbegleitung in dem Mannheimer Seniorenheim, Barbara Foshag, zu. Und auch die Hilfe eines sozialen Roboters wie Oskar bringe dem Personal noch recht wenig. „Es muss immer jemand dabei sein“, erzählt sie. Oskar ist daher auch bei weitem nicht täglich im Einsatz. Zu aufwendig wäre das.
Entlastung für Pflege muss aus anderer Richtung kommen
Soziale Roboter seien ja ganz nett, sagt Brysch. Der Königsweg für Entlastung von Pflegepersonal aber liegt nach seinen Worten darin, dass die Dokumentationspflichten KI-unterstützt mit deutlich weniger Aufwand erledigt werden können. Rund 40 Prozent der Arbeitszeit der Altenpflegerinnen und -pfleger entfalle Schätzungen zufolge auf die Berichtspflichten. „Wenn wir nur um die Hälfte davon runterkommen, wäre schon viel gewonnen.“
Um Pflegepersonal zu entlasten, bedürfe es insgesamt neuer Herangehensweisen, sagt Manuela Striebel-Lugauer, die die Abteilung Alter, Pflege und Gesundheit bei der Diakonie Baden leitet. Der Einsatz von innovativer Technik könne da ein Baustein sein. Aber: „Es wird nicht die eine Lösung geben und ich sehe nicht, dass „Pflegeroboter“ Pflegepersonal ersetzen können.“
Durchaus Potenzial, Nutzen ist aber noch gering
Der Prozess des Pflegens selbst könne aktuell nicht durch Robotik unterstützt werden, sagt auch Nadine Reussel-Distler, die bei der Diakonie Baden das Projekt „pulsnetz MuTiG – Mensch und Technik im Gemeinwesen“ leitet. Es sei zudem auch fraglich, ob dies ethisch gewünscht ist. Das Fazit laute daher: „Aktuell ist Robotik kein probates Mittel gegen Fachkräftemangel.“
Das baden-württembergische Sozialministerium betont ebenfalls die Grenzen der bisherigen Möglichkeiten. „Soziale Roboter haben viel Potenzial“, sagt ein Sprecher. In der Praxis aber habe sich gezeigt, dass diese in der Pflege aktuell noch keine Entlastung für das Personal böten, sondern vor allem als Ergänzung in der Betreuung verstanden würden. Insgesamt sei der Einsatz von Robotik in der Pflege in Deutschland noch sehr gering.
Kein Ersatz der Pflegekräfte
Simon Eggert, Geschäftsleiter Forschung beim Zentrum für Qualität in der Pflege richtet seinen Blick auch auf diejenigen, die pflegen: Sie seien zwar offen für hilfreiche digitale Unterstützung. Sie wollten aber nicht in die Situation geraten, in der die Robotik die Pflege bestimmt.
Oskar scheint inzwischen etwas erschöpft. Manchmal, wenn das WLAN hängt, hängt auch er. Und wenn viele Personen sprechen, ist er mitunter etwas verwirrt. Seine Antworten sind auf Dauer floskelhaft und ähneln sich sehr. Smalltalk geht gut, mehr wäre dann doch ermüdend, sagt auch Heimleiter Bastian. Bald soll Oskar weiterziehen in eine andere Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung. „Ich werde ihn vermissen“, sagt Maria Karusseit. (dpa)