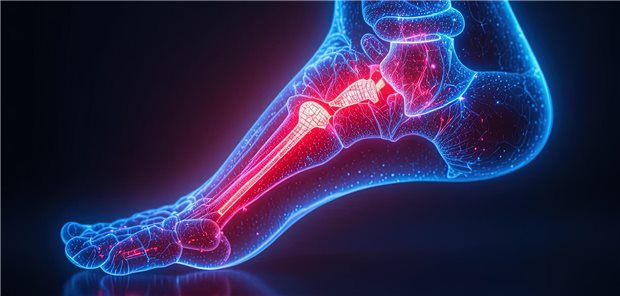Patientenrechte
Einsicht in die Krankenakte: „Es fehlt an einer gesetzlich geregelten Sanktion“
Das Bürgerliche Gesetzbuch verpflichtet Ärztinnen und Ärzte zur Auskunft über mögliche Fehler. Doch ohne Sanktionen bleibt die Vorschrift oft wirkungslos. Der Fachanwalt für Medizinrecht Johannes Brocks plädiert für klare Regelungen, eine offene Fehlerkultur – und besseren Zugang zu den vollständigen Patientenakten.
Veröffentlicht:
Das Akteneinsichtsrecht ergibt sich aus § 630g Absatz 1 Satz 1 BGB und aus der Datenschutz-Grundverordnung, der DSGVO, so Medizinjurist Dr. Johannes Brock.
© Studio_East / stock.adobe.com
Herr Dr. Brocks, Sie vertreten seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten in Fragen des Medizinrechts. Was sind die rechtlichen Grundlagen – und warum hakt es in der Praxis trotzdem?
Eine echte Lücke besteht im Zusammenhang mit § 630c Absatz 2 Satz 1 im Bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB. Dort ist die Pflicht der Behandler beschrieben, auf Nachfrage mitzuteilen, ob sie selbst oder Vorbehandelnde Fehler gemacht haben. Geschieht dies jedoch nicht, fehlt es an einer gesetzlich geregelten Sanktion, sodass der Regelungsinhalt der Vorschrift in der Praxis so gut wie nicht umgesetzt wird.
Die AOK-Befragung zeigt, dass viele Versicherte Schwierigkeiten haben, Einsicht in ihre Krankenakte zu bekommen. Warum ist das so?
Das Akteneinsichtsrecht ergibt sich aus § 630g Absatz 1 Satz 1 BGB und aus der Datenschutz-Grundverordnung, der DSGVO. Der Europäische Gerichtshof hat bereits mit einem Urteil vom 26. Oktober 2023 entschieden, dass sich ein Anspruch auf eine kostenlose Übermittlung der Patientenakte aus der DSGVO ergibt. Warum es in der Praxis dennoch hakt, ist schwer zu erklären.
Zur Not sollten Patientinnen und Patienten mit einer Meldung bei der zuständigen Datenschutzbehörde drohen. Werden die Unterlagen nicht zeitnah zur Verfügung gestellt, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor, der geahndet werden könnte.

Dr. Johannes Brocks ist Fachanwalt für Medizinrecht.
© Andreas Hornoff
In Ihrer Kanzlei betreuen Sie viele Fälle von Behandlungsfehlern, gerade auch bei Geburtsschäden. Welche Fehler treten besonders häufig auf?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Behandlungsfehlerarten. Wir stellen aber vermehrt fest, dass schlicht und ergreifend zu spät gehandelt wird.
Es spricht viel dafür, dass dies auch auf der Personalmangelsituation beruhen könnte. Das entlastet die Krankenhäuser aber nicht, die eine ausreichende Personaldichte vorhalten müssen und den Patientinnen und Patienten aus dem Behandlungsvertrag auch schulden. Verspätetes Eingreifen und Reagieren ist sicher eines der Probleme, die – gerade bei Geburtsschäden – häufig und zwar zu häufig vorkommen.
Welche Rolle spielen Hausärztinnen und Hausärzte bei Verdacht auf Fehler?
Hausärztinnen und Hausärzte spielen tendenziell eine kleine Rolle bei Verdacht auf Behandlungsfehler. Es ist eher eine Tendenz feststellbar, dass Hausärztinnen und Hausärzte sich zurückhalten oder von weiteren Schritten abraten. Das gilt aber nicht nur für diese Berufsgruppe, sondern auch für andere Nachbehandelnde. Jedoch gibt es aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die offen unterstützen, wenn Patientinnen und Patienten Unterlagen oder Einschätzungen benötigen.
Individuelle Gesundheitsleistungen werden in vielen Praxen angeboten, oft ohne gesicherte Evidenz. Birgt das rechtliche Risiken?
Ernstzunehmende Risiken kann ich nicht unbedingt erkennen. Wenn eine solche Leistung angeboten wird und keine gesicherte Evidenz hat, muss darüber natürlich gesprochen werden.
Die Entscheidung liegt letztlich aber bei den Patienten und Patientinnen, die mündig und selbstbestimmt darüber entscheiden können, ob sie diese in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
Nicht immer ist klar, wer der tatsächliche Behandler war, besonders bei komplexen Eingriffen oder in größeren Einrichtungen. Wie wichtig ist diese Klarheit aus juristischer Sicht?
Die Klarheit ist sehr wichtig. Die Behandler selbst sind neben dem Krankenhausträger aus dem Deliktsrecht schadensersatzpflichtig. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer neben dem Krankenhausträger noch haftet. Die Klarheit lässt sich aber durch Einsicht in die Unterlagen schnell erlangen.
Sollte es eine generelle Informationspflicht bei jedem erkannten Fehler geben?
Eine solche Regelung wäre nicht nur für die geschädigten Patientinnen und Patienten sehr wünschenswert. Sie wäre auch für die ohnehin finanziell angespannte Lage der Solidargemeinschaft hilfreich. Diese Regelung ließe sich durch eine Änderung des § 630c Absatz 2 Satz 2 BGB umsetzen. Das wäre sicher sinnvoll und würde vor allem zu einer offeneren Fehlerkultur beitragen.
Gleichzeitig würde eine solche Änderung auch nur dann wirklich etwas bewirken, wenn die Nichtbeachtung zu einer Sanktion führen würde, die aktuell in § 630c Absatz 2 Satz 2 BGB nicht vorgesehen ist.
Sollte der Nachweis auch gelten, wenn die Kausalität zwischen Fehler und Schaden als überwiegend wahrscheinlich gilt?
Was die AOK fordert, ist vollkommen richtig. Es ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar, dass man sich hiergegen inhaltlich wehrt. Denn letztlich geht es um eine (Wieder-)Anpassung der im allgemeinen Vertragsrecht geltenden Rechtslage in ganz Deutschland. Es wird immer wieder in der Diskussion so getan, als verlange man eine Beweiserleichterung für die Patientenseite. Das ist grundlegend falsch.
Können Sie das genauer erklären?
Liegt ein Behandlungs- und/oder Aufklärungsfehler vor, verletzt die Behandlerseite eine Pflicht aus dem Behandlungsvertrag. Daraus folgt eine vertragliche Haftung gemäß §§ 630a, 280 BGB. Anders als im Deliktsrecht – §§ 823 ff. BGB – knüpft der Schadensersatzanspruch hier direkt an die Pflichtverletzung an.
Eine Rechtsgutverletzung – also ein sogenannter Primärschaden, etwa eine konkrete Verletzung des Körpers, wird im vertraglichen Haftungsrecht nicht gefordert. Es genügt, dass die Pflicht aus dem Vertrag verletzt wurde. Rechtsfolge der Pflichtverletzung ist gemäß § 249 Absatz 1 BGB, den entstandenen Schaden zu ersetzen. Im vertraglichen Haftungsrecht muss deshalb im Grundsatz gerade nicht üblicherweise gemäß § 286 der Zivilprozessordnung, kurz ZPO, der Vollbeweis des kausalen Schadens erbracht werden.
Stattdessen reicht es nach § 287 ZPO aus, wenn der Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dargelegt werden kann.
Was bedeutet das für das Arzthaftungsrecht?
Für das Arzthaftungsrecht ist der Bundesgerichtshof von diesem allgemein anerkannten Grundsatz des vertraglichen Schadensersatzrechts abgewichen.
Der Bundesgerichtshof hat für das Arzthaftungsrecht einen Gleichlauf zwischen Deliktsrecht und vertraglichem Schadensersatzrecht geschaffen und entschieden, dass – anders als sonst – im Rahmen der Arzthaftung die Patientenseite auch den kausalen Schaden „vollbeweisen“ muss und insoweit § 286 ZPO angewandt werden müsse.
Hierfür gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Würde man gesetzlich regeln, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Kausalität zwischen Behandlungsfehler und Schaden bei der Beweisführung ausreicht, würde also gerade keine Reduktion der Beweislast erfolgen. Es würde der im vertraglichen Schadensersatzrecht geregelte Normalfall wiederhergestellt werden.
Wie bewerten Sie die Idee eines „Never-Event-Registers“ für gravierende Fehler, auch vor dem Hintergrund möglicher Selbstbelastungen von Leistungserbringern in laufenden Verfahren?
Ein solches Vorgehen ist sicher sinnvoll, um die Qualität der Behandlung zu erhöhen und gravierende Fehler in Zukunft zu vermeiden oder die Zahl solcher zu reduzieren. Eine Selbstbelastung ist nicht zu befürchten, wenn man – wie bereits bei § 630c Absatz 2 Satz 3 BGB – ein Beweisverwertungsverbot regeln würde. Damit könnten Fehler offen dokumentiert werden, ohne dass rechtliche Nachteile zu befürchten wären.
Welche Reformen wären aus Ihrer Sicht am dringendsten nötig?
Die Beweislastverteilung und die Beweismaßstäbe sollten für Patientinnen und Patienten nicht ungünstiger sein als im sonstigen vertraglichen Schadensersatzrecht.
Hier sollte zum Normalfall zurückgekehrt werden. Wichtig wäre sicher auch, einen Verstoß gegen § 630c Absatz 2 Satz 2 BGB zu sanktionieren.
Vielen Dank für das Gespräch.