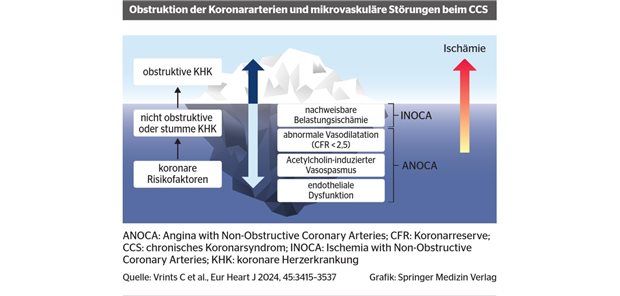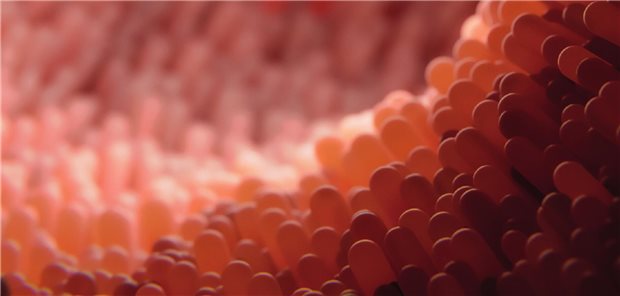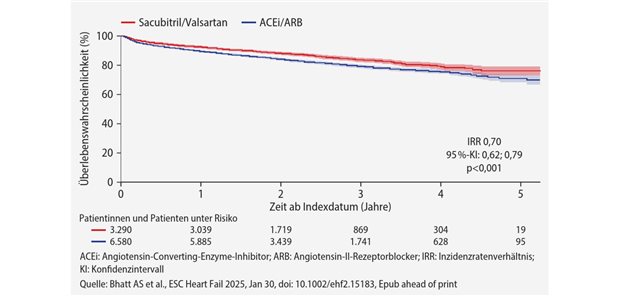Studie beim ESC
"Das Herz mag kein Salz"
Hängt ein hoher Salzkonsum nicht nur mit hohem Blutdruck als Risikofaktor für KHK und Schlaganfall zuzsammen? Auf dem ESC haben finnische Forscher nun Studiendaten präsentiert, die eine Verbindung von Salz und Herzinsuffizienz herstellen.
Veröffentlicht:
Weißes Gold: Zu viel Salz erhöht einer Studie zufolge auch das Risiko für Herzinsuffizienz.
© Sea Wave / stock.adobe.com
BARCELONA. Wer viel Salz zu sich nimmt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Herzinsuffizienz. Das ergibt eine finnische Follow-up-Studie mit 4630 Probanden (Alter: 25 bis 64 Jahre). Diese wurde jetzt auf dem Europäischen Kardiologiekongress (ESC) in Barcelona vorgestellt.
Ein Team um Prof. Pekka Jousilahti vom National Institute for Health and Welfare hat die Teilnehmer der Studienkohorte über einen Zeitraum von 12 Jahren miteinander verglichen. Die Wissenschaftler untersuchten die aufgenommene Salzmenge und erhoben Gewicht, Größe sowie Blutdruck. Daneben wurden weitere Blutparameter analysiert. Die Menge an aufgenommenem Salz ermittelte das Team anhand von 24-Stunden-Urinproben. Im Labor wurden das Urinvolumen bestimmt und 100 ml-Proben analysiert. Ein Gramm Salzkonsum wurde dabei gleichgesetzt mit 17,1 mmol Natriumexkretion.
Hoher Salzkonsum = hohes Risiko
Die Forscher stellten dabei fest, dass innerhalb der 12 Jahre 121 Teilnehmer eine Herzschwäche entwickelten. Dabei hatten Menschen, die mehr als 13,7 Gramm Salz pro Tag konsumierten, ein doppelt so hohes Risiko für Herzinsuffizienz wie jene, die weniger als 6,8 Gram zu sich nahmen.
Jousilahtis Fazit: "Das Herz mag kein Salz!" Das mit zunehmendem Salzkonsum ansteigende Risiko für eine Herzinsuffizienz sei in der Studie sogar unabhängig vom Blutdruck gewesen. Dennoch wisse man zu wenig über den genauen Zusammenhang zwischen konsumierter Salzmenge und Herzschwäche. Weitere Studien mit mehr Teilnehmern seien nötig, um diesen nun zu analysieren, so der Forscher.
Die WHO empfiehlt eine maximale Salzzufuhr von fünf Gramm am Tag für Erwachsene. Die Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention DHL® e. V. hat sich auf eine Obergrenze von 6 Gramm Kochsalz pro Tag festgelegt. Der tatsächliche Konsum liegt aber weit darüber: Der durchschnittliche Salzkonsum liegt in Deutschland laut Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bei 8,4 Gramm (Frauen) und 10 Gramm (Männer). (ajo)