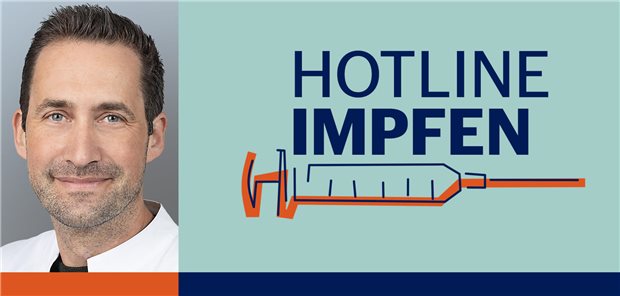Fettleber: Schon bei Kindern häufige Mukoviszidose-Folge
FREIBURG (ars). Bei Kindern mit Mukoviszidose wird häufig zu wenig beachtet, daß außer der Lunge auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen sind. Vor allem chronische Leberstörungen können die Prognose stark beeinflussen. Daher ist es wichtig, sie frühzeitig zu erkennen, zumal eine Therapie mit Ursodesoxycholsäure den Gallefluß verbessert und die Aktivität der Transaminasen normalisiert.
Veröffentlicht:Mit einer Häufigkeit von 1 zu 2500 in der weißen Bevölkerung ist Mukoviszidose die häufigste letale verlaufende Erbkrankheit, wie Professor Martin Stern aus Tübingen bei einem von der Falk Foundation unterstützten Symposium in Freiburg berichtet hat.
| Das zähflüssige Sekret führt zu biliären Obstruktionen und auch zu Entzündungen. | |
Der zugrunde liegende Ionenkanaldefekt bewirkt, daß sowohl in der Lunge als auch in den Gallencanaliculi ein zähflüssiges Sekret entsteht. In der Leber hat das eine biliäre Obstruktion und Entzündung zur Folge.
Hinzu kommen sekundäre toxisch-metabolische Faktoren wie Unterernährung mit Mangelzuständen an essentiellen Fettsäuren, die eine Hepatopathie mit Leberverfettung auslösen.
Das Muster der Manifestationen wechselt mit dem Lebensalter: Eine Cholestase tritt bereits bei manchen Neugeborenen auf, Kleinkinder haben zu 20 bis 60 Prozent eine Fettleber und zu 15 Prozent eine Fibrose, Schulkinder zu hohen Anteilen eine Mikrogallenblase sowie etwa fokale biliäre Zirrhosen.
Zu Komplikationen dieser langsam progredienten Veränderungen in den Organen wie Ikterus oder portaler Hypertonus mit Ösophagusvarizenblutung kommt es dann im späteren Verlauf, und zwar bei Jugendlichen und Erwachsenen.
Wie Stern in Freiburg erläuterte, wird die Diagnose einer Lebererkrankung gestellt, wenn klinische, enzymatische und sonografische Befunde länger als zwölf Monate bestehen bleiben: Die Leber ist vergrößert, die Milz tastbar, Enzyme wie SGOT, SGPT, GGT und ALP sind bis zum Vierfachen erhöht und bei der Ultraschall-Untersuchung fallen etwa eine Hyperechogenität mit Vergröberung und Noduli auf.
Zur Therapie der Symptome eignet sich Ursodeoxycholsäure (etwa Ursofalk®). Die meisten Studien kamen zu dem Ergebnis, daß sie einen protektiven Effekt auf die Leberzellen hat und den Umsatz an Gallensäuren sowie die Cholerese steigert. Allerdings ließ sich bisher keine Verbesserung der Überlebenszeit nachweisen. Für diese Therapie sei die Evidenzbasis gering, sagte Stern, "aber alles in allem herrscht ein gedämpfter Optimismus".