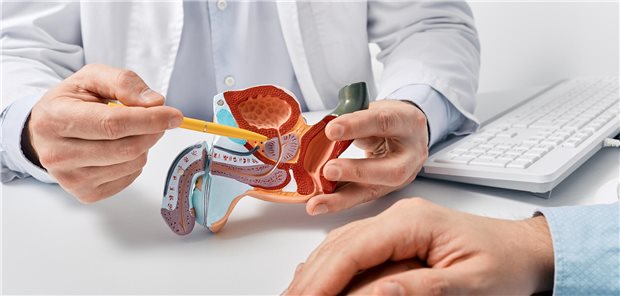KOMMENTAR
Juristische Grauzonen
Zellen und Gewebe sind seit langem wertvoll für die Medizin. Ob Hirnhäute und Gehörknöchelchen von Toten oder das abgestoßene Plazentargewebe - in der Vergangenheit sind allerdings Gewebe oder Organteile oft in einer juristischen Grauzone den Menschen entnommen und verwendet worden. Das Transplantationsgesetz von 1997 hat Klarheit nur zum Teil geschaffen.
Es bezieht sich zwar auf Organe und Gewebe, regelt aber konkret im wesentlichen, wie solide Organe entnommen, verteilt und verwendet werden dürfen. Ein Beispiel: Das Gesetz schließt den Handel mit Organen aus. Aber viele Gewebe wie Knorpel, Haut oder Faszien werden trotzdem erworben, weiterverarbeitet und verkauft - das ist vor Verabschiedung des Gesetzes so gewesen und danach ebenso.
Leberreste eignen sich als Quelle für Hepatozyten
Die Regelungslücke zu schließen, wird immer dringlicher. Denn die Möglichkeiten, Gewebe oder Teile von Organen zu nutzen, erweitern sich rasant, wie jetzt bei der Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft in Kiel deutlich geworden ist. So lassen sich postmortal aus Lebern, die sich nicht für eine Transplantation eignen, noch Hepatozyten isolieren und aufbereiten, um sie Patienten zu übertragen.
Und Leberreste, die nach dem Splitten eines Organs übrig bleiben, eignen sich als Quellen für Hepatozyten. Auch Abschnitte von Blutgefäßen Toter werden Kranken mit akuten Gefäßprotheseninfektionen implantiert. Und selbst für Gewebe und Organteile in suboptimalem Zustand finden sich Anwendungsmöglichkeiten.
Diese Entwicklung ist grundsätzlich zu begrüßen, schließlich dient sie kranken Menschen. Bislang aber fehlt es an regional einheitlichen Modalitäten für die Zustimmung zur Spende von Zellen und Geweben, an klaren Regeln, wie sie weiterverwendet werden dürfen und wer die Weiterverwendung kontrolliert. Auch Ärzte beschleicht ein ungutes Gefühl, wenn sie nicht genau wissen, was mit entnommenen Zellen und Geweben eigentlich geschieht. Außerdem gilt es inzwischen, eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umzusetzen.
Sanktionen gegen Kliniken, die die Meldepflicht vernachlässigen
Aber auch die Bemühungen um postmortale solide Organe müssen konsequenter werden. Vielleicht sollten Krankenhäusern, die nach sieben Jahren einer soliden rechtlichen Grundlage ihrer Meldepflicht potentieller Spender nicht nachkommen, jetzt Sanktionen drohen. Nicht einmal die Hälfte der Kliniken engagieren sich in der Organspende. Das Gesetz allein kann da nicht helfen, in der Praxis sind die Klinikmitarbeiter gefragt. Zwei Drittel der Menschen, die gefragt werden, ob sie nach dem Tod ein Organ spenden wollen, stimmen zu.
Lesen Sie dazu auch den Hintergrund: Leberzell-Verpflanzung kann Patienten mit akutem Leberversagen vor der Organtransplantation bewahren