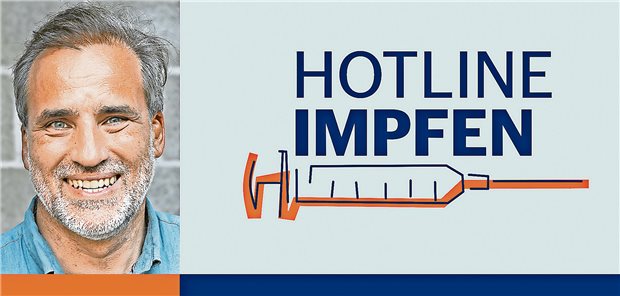Spätschäden gibt es auch nach leichten Hirn-Traumen
Leichte Schädel-Hirn-Traumen im Sport sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, raten Neurologen. Zwar gingen mehr als 90 Prozent der Schädel-Hirn-Traumen im Sport ohne Bewußtseinsstörungen einher, so Professor Manfred Holzgraefe aus Seesen und Privatdozent Markus Otto aus Göttingen. Wiederholen sich die leichten Schädel-Hirn-Traumen jedoch, womit etwa bei Boxern oder bei Kopfball-Spezialisten im Fußball gehäuft gerechnet werden muß, sind Spätschäden zu befürchten.
Veröffentlicht:Leichte Schädel-Hirn-Traumen sind oft schwierig zu erkennen. Frühzeichen sind nach Angaben von Holzgraefe und Otto Kopfschmerzen, Schwindel, Aufmerksamkeits- und Denkstörungen sowie Übelkeit und Erbrechen. Wenn Tage bis Wochen nach dem Ereignis immer noch Kopfschmerzen oder andere Symptome bestehen, etwa Benommenheit, Reizbarkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit, Schlaf- und Stimmungsstörungen, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma vor.
Kriterien für eine rasche Diagnostik am Spielfeldrand
Zur Diagnostik am Spielfeldrand hat die American Academy of Neurology (AAN) eine standardisierte Untersuchung für Nichtärzte entwickelt. Sie beinhaltet Fragen nach:
- Orientierung (Zeit, Ort, Situation);
- Gedächtnis: Wiederholung von fünf Wörtern in drei Durchgängen;
- Konzentration: rückwärts Aufsagen von drei bis sechs Zahlenreihen sowie der Monate.
Hinzu kommen:
- eine orientierende Untersuchung auf Gefühls- und Koordinationsstörungen sowie eine Kraftprüfung;
- Belastungstests wie Sprints oder Kniebeugen mit Beachtung assoziierter neurologischer Symptome;
- erneutes Abfragen der Wörter vom ersten Teil des Tests.
Ärzte sollten besonders auf die Untersuchung der Hirnnerven Wert legen und dabei vor allem auf den Geruchssinn, raten Holzgraefe und Otto. Die beiden Neurologen sind Mitglied der "Arbeitsgemeinschaft Neurologie und Sport" der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Durch die Beschleunigung des Gehirns können die Riechnerven (Fila olfactorii) verletzt worden sein (Akt Neurol 30, 2003, 519).
In Deutschland ereignen sich jährlich nach Schätzungen etwa 24000 Schädel-Hirn-Traumen bei sportlichen Aktivitäten. Etwa jeder zehnte Betroffene entwickelt ein chronisches posttraumatisches Syndrom mit Kopf- und Nackenschmerzen, Schwindel und neuropsychologischen Defiziten. Sind bei dem Ereignis kurzfristige Bewußtseinsstörungen aufgetreten, sollte die Sporttauglichkeit frühestens dann attestiert werden, wenn der Sportler eine Woche symptomfrei ist, so die Neurologen.
War es bereits das zweite Schädel-Hirn-Trauma, verlängert sich das Sportverbot auf mehrere Wochen. Nach Bewußtlosigkeit sind ein kranielles Computertomogramm oder Magnetresonanztomogramm indiziert. Betroffene sollten erst dann wieder Sport treiben, wenn auch unter Belastung keine Symptome mehr auftreten. Bei mehr als zwei Schädel-Hirn-Traumen sollten Betroffene die Saison beenden.
Gehirnschädigungen können kumulieren
Bei wiederholten Schädel-Hirn-Traumen können die Schädigungen des Gehirns kumulieren, besonders wenn sich die Symptome des ersten Schädel-Hirn-Traumas noch nicht vollständig zurückgebildet haben. Beeinträchtigt sind dann erfahrungsgemäß die Kognition, das Gedächtnis sowie visuelle, motorische und sensorische Leistungen.
Eine Studie mit insgesamt 250 Profiboxern Ende der 1960er Jahre ergab bei 17 Prozent der Untersuchten klinische Zeichen einer Beeinträchtigung. Eine Untersuchung aus dem Jahre 2000 kam auf 20 Prozent chronische Hirnschäden.
Die Schädigungen, die durch Schädel-Hirn-Traumen entstehen, ähneln denen der Alzheimer-Demenz. Daher gibt es Empfehlungen, zumindest bei Profiboxern jährlich eine bildgebende Hirn-Diagnostik zu veranlassen. Die Häufigkeit einer Demenz korreliert zudem mit dem Auftreten eines bestimmten Apolipoprotein-E-Allels (Epsilon 4). Sportlern, die eine Karriere als Boxer anstreben, sollte daher eine Typisierung angeboten und von der Sportart abgeraten werden, sofern sie Träger des Allels seien, meinen Holzgraefe und Otto.
Es gibt Frühzeichen für leichte Traumen
Leichte Schädel-Hirn-Traumen sind oft schwierig zu erkennen. Frühzeichen sind Kopfschmerzen, Schwindel, Aufmerksamkeits- und Denkstörungen sowie Übelkeit und Erbrechen. Wenn Tage bis Wochen nach dem Ereignis immer noch Kopfschmerzen oder andere Symptome bestehen, etwa Benommenheit, Reizbarkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit, Schlaf- und Stimmungsstörungen, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma vor. Besonders gefährdet sind etwa Fußballspieler, Eishockey-Spieler, Inline-Skater, Radfahrer, alpine Skifahrer und Boxer. (ner)