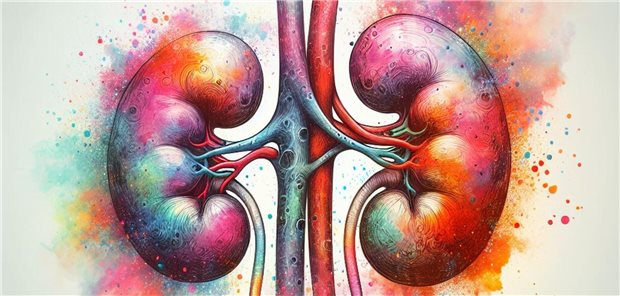Toxin hilft besonders Kleinkindern mit Spastik
MÜNCHEN (sto). Die Therapie mit Botulinumtoxin - etwa vom Typ A - bei spastischen Bewegungsstörungen als Folge einer infantilen Zerebralparese ist ein Behandlungsverfahren, das sich im vergangenen Jahrzehnt auch international durchgesetzt hat. Die besten Behandlungserfolge werden in den ersten fünf Lebensjahren erzielt.
Veröffentlicht:Darauf hat der Münchner Pädiater Professor Florian Heinen hingewiesen. Die Behandlung sei inzwischen weltweit etabliert, berichtete der Leiter der Abteilung für Pädiatrische Neurologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München. Durch die Injektion unter Ultraschallkontrolle und die Einbeziehung weiterer Muskeln im Bereich der oberen und unteren Extremität werde bei den Kindern eine "flüssige Motorik" erreicht, sagte Heinen bei einer Veranstaltung des Unternehmens Allergan in München.
Daß die besten Erfolge in den ersten fünf Lebensjahren erzielt werden, belegen die Ergebnisse einer Untersuchung mit mehr als 400 Patienten, die seit dem Jahr 2000 mit Botulinumtoxin behandelt wurden. Die Daten von 316 Patienten sind bereits vollständig ausgewertet. Die Injektionen mit Botulinumtoxin seien etwa alle drei bis vier Monate erforderlich und ergänzten andere Therapien wie Krankengymnastik, die Versorgung mit Orthesen und anderen Hilfsmitteln sowie orthopädische Operationen, sagte Heinen.
Die Therapie mit Botulinumtoxin (Botulinumtoxin A wird vom Unternehmen als Botox® hergetellt und seit kurzem auch selbst vertrieben) biete sich besonders beim funktionellen dynamischen Spitzfuß an, der häufigsten therapiebedürftigen Deformität bei Patienten mit infantiler Zerebralparese.
Die Spastik in der Wadenmuskulatur bewirke, daß die Kinder auf den Zehen laufen, was unbehandelt zu einer strukturellen Muskelverkürzung führe. Durch die Injektion von Botulinumtoxin an verschiedenen Stellen des betroffenen Muskels soll eine dosierte Schwächung der spastisch hypertonen Muskulatur erreicht werden.
Das Toxin sei keine "Wunderdroge", so Heinen. Durch die Therapie lasse sich bei manchen Kindern aber ein bleibender Effekt erzielen. Zudem könne eine Op in ein Alter verschoben werden, in dem das Risiko für ein Spitzfuß-Rezidiv geringer ist.