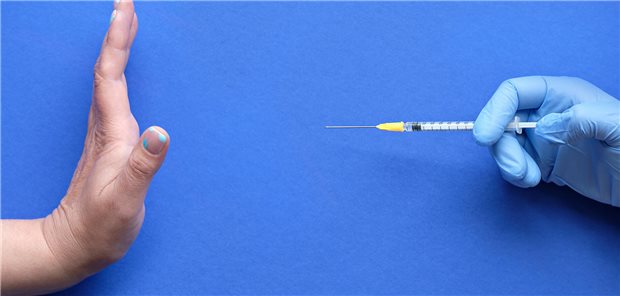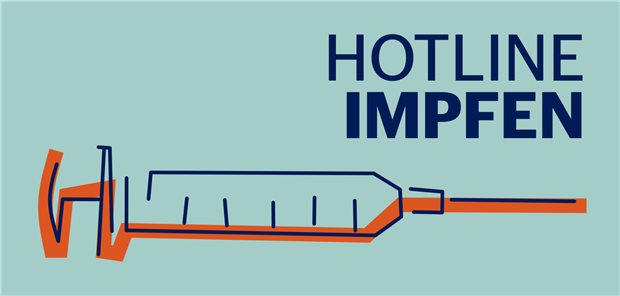Paralympics
Boosting statt Doping
Die sportlichen Leistungen von behinderten Athleten sind grandios. Aber auch unter ihnen gibt es einige schwarze Schafe: Durch Dornen und Elektroschocks versuchen manche querschnittsgelähmte Athleten, ihrem Körper noch mehr Leistung abzuringen.
Veröffentlicht:
Boosting im Rennrollstuhl bringt bis zu zehn Prozent mehr Leistung.
© Shariff Che'Lah / fotolia.com
LONDON. Beim Boosting machen sich Sportler ein Phänomen zunutze, das als autonome Dysreflexie bekannt ist: Bei Rückenmarksläsionen vom sechsten Brustwirbel aufwärts ist die Herz-Kreislauf-Regulation durch den Sympathikus beeinträchtigt, normalerweise sind die Betroffenen hypoton und bradykard.
Durch bestimmte nozizeptive Stimuli wie Überdehnung von Blase oder Darm, Stress und Infektionen kann jedoch eine massive, nicht gegenregulierte Sympathikusaktivierung ausgelöst werden, die unter anderem Blutdruck und Herzfrequenz hochjagt.
"Wenn eine autonome Dysreflexie zufällig im Wettkampf auftritt, dann ist das natürlich super für den Athleten", sagt Dr. Thomas Abel von der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Doch manche Leistungssportler helfen dem Zufall auch nach: Laut Abel ist es schon vorgekommen, dass Sportler sich durch einen Dorn in der Rückenlehne des Rollstuhls malträtierten, um über die Entzündung die gewünschte Sympathikusaktivität zu induzieren.
Elektroschocks am Hoden
Ein querschnittsgelähmter Rollstuhl-Kletterer, Brad Zdanivsky aus Vancouver, bekannte gegenüber BBC sogar, dass er zu diesem Zweck Elektroschocks angewendet habe, an Beinen, Zehen und Hoden.
In den meisten Fällen, so Abel, tricksen die Athleten jedoch mithilfe einer gut gefüllten Harnblase.
Schon 1994 wurde Boosting vom International Paralympic Committee (IPC) als Dopingmethode eingestuft und verboten. Auch für London hatte das IPC entsprechende Kontrollen angekündigt.
Nach Einschätzung von Abel ist es jedoch fast unmöglich, Boosting nachzuweisen.
Athleten, die vor dem Wettkampf einen systolischen Blutdruck von über 180 mmHg haben, werden daher auch nur "zum Selbstschutz" von der Teilnahme ausgeschlossen.
Schließlich kann eine autonome Dysreflexie auch spontan auftreten. Umgekehrt können Sportler das Boosting per Blasenfüllung so gezielt steuern, dass Blutdruck und Herzfrequenz erst während des Wettkampfs nach oben gehen.
Dementsprechend gibt es bisher auch keine offiziell überführten Boosting-Sünder.
Man kann nur schätzen, wie viele gelähmte Athleten schon einmal versucht haben, sich durch Boosting fitter zu machen.
Leistungsförderung mit Nebenwirkung
Bei einer anonymen Umfrage während der Paralympics in Peking gab die Hälfte von 99 Teilnehmern mit Querschnittslähmung an, zumindest von Boosting gehört zu haben.
Jeder Sechste hatte die leistungssteigernde Wirkung bereits selbst ausprobiert (Bhambhani Y et al. Disabil Rehabil 2010).
Trotzdem glaubt Abel, dass Boosting "kein großes Problem" im Behindertensport ist - und dass das Thema in den Publikumsmedien übermäßig "aufgebauscht" wird.
Dafür sprechen auch die Zahlen: In London gibt es unter den 4200 Teilnehmern weniger als 100, bei denen eine Leistungssteigerung durch Boosting überhaupt infrage käme.
Wie bei anderen Dopingmethoden gehen Sportler beim Boosting ein gesundheitliches Risiko ein. Zwar ist laut Abel der Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz im Wettkampf nicht zwangsläufig mit einer vitalen Gefährdung verbunden.
Durch Manipulationen etwa an der Harnblase drohen jedoch Infektionen und im schlimmsten Fall Nierenschäden.
Topleistungen trotz beschränkter Kraft
Behinderte Sportler erzielen bei den Paralympics Höchstleistungen. Sie brauchen den Vergleich mit ihren kerngesunden Kollegen bei Olympia nicht zu scheuen:
Die teilweise gelähmte Schwimmerin Kirsten Bruhn holte zum Beispiel ohne Kraft der Beine Gold in 100 m Brust. Die 42-Jährige aus Neumünster brauchte für die Distanz 1:35.50 Minuten und war elf Sekunden schneller als die Nächstplatzierte. Bruhn ist seit einem Motorradunfall 1991 inkomplett querschnittsgelähmt. Zum Vergleich: Bei der Olympiade holte die 25-jährige Ruta Meilutyte aus Litauen die Goldmedaille über 100 m Brust in 1:05,47 Minuten.
Die Goldmedaille als Diskuswerfer hat Sebastian Dietz bei den Paralympics gewonnen. Der 27-Jährige - der seit einem Autounfall vor acht Jahren teilweise gelähmt ist - siegte mit 38,54 Metern. In der gleichen Disziplin wurde mit Robert Harting ebenfalls ein Deutscher Olympiasieger. Der 27-Jährige warf den Diskus mit ganzer Kraft seines Körpers 68,27 Meter weit.
Der deutsche Ruder-Mixed-Vierer mit der gesunden Steuerfrau Katrin Splitt hat bei den Paralympics die Silbermedaille über 1000 Meter in 3:21,44 Minuten gewonnen. Im Boot sitzen zwei seheingeschränkte Männer und zwei körperbehinderte Frauen: Astrid Hengsbach, Tino Kolitscher, Kai-Kristian Kruse und Anke Molkenthin. Zum Vergleich: Der deutsche Frauen-Vierer bei Olympia brauchte für die doppelte Distanz 6:38,09 Minuten für die Silbermedaille. (eis)