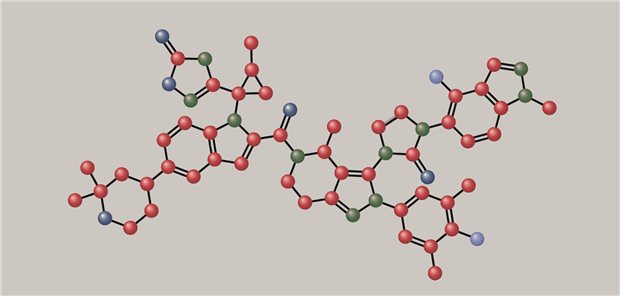Hunger, Krankheit und ein Funken Hoffnung
Nach der Dürre leiden die Menschen in der Region Wajir im Nordosten Kenias an den Folgen der Unterernährung. Medizinische Versorgung gibt es kaum. Teams der Organisation LandsAid helfen mit einfachen Mitteln.
Veröffentlicht:
Latexhandschuhe aufblasen und lustige Gesichter darauf malen: Das kommt nicht nur bei Kindern in der Charité an - sondern auch bei dem Jungen in Kenia.
© Worm
BERLIN. Die Eindrücke aus Nordost-Kenia sind für Michael Worm noch ganz frisch - auch wenn er bereits einige Wochen wieder zurück ist in Deutschland.
Denn die erschütternden Bilder, die Schreckensmeldungen über die Hungersnot am Horn von Afrika, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt, waren drei Wochen lang für den Intensivpfleger der Charité allgegenwärtig.
Als ehrenamtlicher Helfer war er für die Hilfsorganisation "LandsAid" in einem Dürregebiet in Kenia im Einsatz. "Vor allem in den Dörfern fehlt es an allem: Essen, Trinken, Medikamente und medizinischer Versorgung."
Helfer sind einzige Hoffnung auf medizinische Versorgung
Mit einem Landrover fuhr das vierköpfige medizinische Team von LandsAid in abgelegene Dörfer rund um das Regionalzentrum Griftu, um dort die Menschen zu versorgen.
Obwohl die Helfer nur einfachste medizinische Geräte, wie Stethoskop, Blutdruckmessgerät, Thermometer sowie eine Babywaage und Medikamente dabei hatten, waren sie für die Dorfbewohner die einzige Hoffnung auf eine medizinische Versorgung.
"Jeden Tag, wenn wir unsere Zelte in einem Dorf aufschlugen, standen die Patienten bereits Schlange vor der Hütte, die wir als Behandlungsraum ausgesucht haben", erinnert sich Worm.
Er war die erste Anlaufstelle für Patienten: Leichtere Fälle behandelte er selbst, Patienten mit schwereren Erkrankungen wurden von dem Team-Arzt übernommen.
Schwer erkrankte Patienten kamen in die Klinik
"Vorab machten wir aber immer eine Triage - dabei haben wir die Patienten zuerst behandelt, die am schwersten erkrankt waren und am dringendsten Hilfe brauchten", berichtet Worm. So versorgte das medizinische Team bis zu 150 Patienten am Tag.
"Die Menschen leiden vor allem an Durchfallerkrankungen, Hautinfektionen, Entzündungen der Atemwege, der Augen und Ohren", sagt Worm. Sie bekamen Schmerzmittel, Antibiotika und ORS, eine wässrige Lösung von Glukose, Natriumchlorid und anderen Elektrolyten.
Das Team begegnete aber auch Patienten mit Lungenentzündungen, Tuberkulose und Malaria. Die schwersten Fälle überwiesen sie an eine Klinik in Griftu.
Kaum Wasser und Nahrung
"Allerdings ist das Krankenhaus nicht mal annähernd mit einer deutschen Klinik vergleichbar. Es fehlt an Fachpersonal und medizinischer Grundausstattung - nicht einmal ein Röntgengerät steht den Ärzten dort zur Verfügung", erinnert sich Worm.
Die Kranken werden mit recht primitiven Mitteln versorgt. "Viele der schwer erkrankten Patienten, die in Deutschland relativ gute Überlebenschancen hätten, sind dort dem Tode geweiht", sagt der 44-jährige Intensivpfleger. Man kann seiner Stimme anmerken, wie sehr ihm das noch zu schaffen macht.
Ein Problem, das alles überlagert, ist aber laut Worm, dass die Menschen nicht genug Wasser und Nahrung haben. "Keiner unserer Patienten wog mehr als 60 Kilogramm", berichtet er.
Immer wieder mussten die Helfer schwer unterernährte Kinder ins Krankenhaus in Griftu bringen. Die kleinen Patienten mit einer minder schweren Unterernährung päppelten die Helfer mit mitgebrachter Baby-Nahrung auf.
Mit Kleinigkeiten Kinder glücklich gemacht
Manchmal konnte Michael Worm aber auch ohne Medikamente helfen. Für die Kinder hat er Latexhandschuhe aufgeblasen und lustige Gesichter darauf gemalt.
"Das machen wir auch für die Kinder auf den Intensivstationen der Charité. Sie finden es toll. Auch in Kenia hat es die Kinder glücklich gemacht", freut sich der Intensivpfleger.
Am meisten hat es ihn beeindruckt, wie tapfer die Menschen mit der schwierigen Situation umgehen. Wie aufgeschlossen und höflich sie trotz der schlimmen Lebensbedingungen sind.
Nach drei Wochen Einsatz hat Worm das Land mit der Hoffnung verlassen, dass es den Menschen dort bald wieder etwas besser geht. Denn vor seiner Abreise hat es stark geregnet - erstmals seit zwei Jahren.