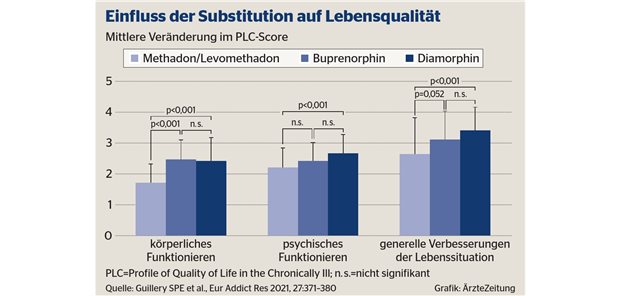Kein Bedarf an mehr Flexibilität für Substitutionsärzte
BERLIN (fst). Weniger Bürokratie für Ärzte, die suchtkranke Patienten behandeln, ist nicht in Sicht: Die Bundesregierung plane keine Änderungen im Betäubungsmittel-Recht, heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der grünen Bundestagsfraktion.
Veröffentlicht:Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Flach (FDP) verweist dazu auf "bedeutsame Erleichterungen", die 2009 eingeführt worden sind. Dazu gehöre etwa die "Zwei-Tages-Verschreibung", die es Ärzten erlaubt, ein Substitutionsmittel in der bis zu zwei Tagen benötigten Menge zu verschreiben, um so die Versorgung von Patienten vor allem an Wochenenden sicherzustellen.
Damit habe die Regierung einem drängenden Wunsch von Ärzten Rechnung getragen. "Derzeit" sieht das Ministerium keinen Bedarf für weitere Änderungen der einschlägigen Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) (wir berichteten kurz).
Ein klares Nein kommt von Flach auch zu erweiterten Ab- und Mitgabemöglichkeiten von Substitutionsmitteln durch Ärzte. Hier gibt es nur eine Ausnahmeregelung für Codein oder Dihydrocodein - und dabei solle es auch bleiben.
Damit verhallt der Wunsch von Ärzten nach mehr Flexibilität ungehört: In einer Befragung aktiv substituierender Ärzte (IMPROVE-Studie) haben sich 47 Prozent der Befragten für weniger Bürokratie und Restriktionen ausgesprochen.
Dies sei der Bundesregierung bekannt, schreibt Flach, verweist aber darauf, dass 49 Prozent der Ärzte im Missbrauch und der unerlaubten Weitergabe von Substitutionsmedikamenten ein "erhebliches Problem" sehen, 17 Prozent sogar ein "besonders schwerwiegendes Problem".
Die Grünen hingegen kritisieren, die Drogenpolitik der Bundesregierung "setze auf Repression statt auf Schadensminderung und Hilfe", sagte der Abgeordnete Harald Terpe, Sprecher für Drogen- und Suchtpolitik.
Vielen werden wieder rückfällig
Seit 2009 sei zu den damals schon bestehenden Einrichtungen zur Behandlung opiatabhängiger Patienten keine einzige neue hinzugekommen, monieren die Grünen.
Der steigenden Zahl von Substitutionspatienten - nach Angaben der Bundesopiumstelle sind es aktuell 76.200 - stehe eine stagnierende Zahl von Ärzten gegenüber, die entsprechend qualifiziert ist.
Eine diamorphingestützte Substitutionsbehandlung erhalten gegenwärtig nach Angaben der Regierung lediglich bundesweit 360 Patienten.
Die Bundesregierung dagegen verweist auf Ergebnisse der vom BMG in Auftrag gegebenen PREMOS-Studie ("Langfristige Substitution Opiatabhängiger: Prädiktoren, Moderatoren und Outcome").
Danach sei die Substitutionstherapie in Deutschland "insgesamt betrachtet effektiv", die "allgemeinen primären Ziele (würden) überwiegend erreicht".
Gezeigt hat die PREMOS-Studie auch, dass die meisten der behandelten Patienten (85 Prozent), die als abstinent klassifiziert wurden, nach sechs Jahren wieder in einer Substitutionstherapie landen - also rückfällig geworden sind.
Dessen ungeachtet will die Regierung nicht vom Ziel der Abstinenz (Paragraf 5 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 BtMVV) in der Substitutionsbehandlung abweichen.
"Der Behandlungsplan sollte in erster Linie auf die schrittweise Herstellung der Betäubungsmittelabstinenz ausgerichtet sein", schreibt Flach und verspricht lediglich, man wolle die Diskussion über die Ergebnisse der PREMOS-Studie "aufmerksam beobachten".