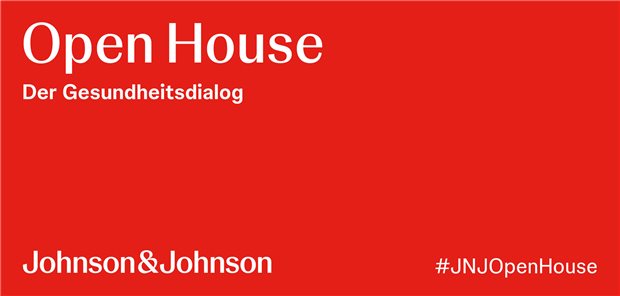Leukämiediagnostik
Münchner Ärzte setzen eigenes KI-Tool auf
Aktiv gestalten, statt nur darüber zu reden: Bereits 2015 hatten drei Münchner Hämatologen die Idee zu einem KI-gestützten Instrument für die Leukämiediagnostik. Heute arbeiten sie damit.
Veröffentlicht:
1,3 Millionen Proben lagern in den Gefrierschränken des MLL. Eine Biobank, die vom Labor auch für KI-Projekte genutzt wird.
© MLL Münchner Leukämielabor Gmb
Es ist ein Datenschatz, von dem viele Forscher nur träumen können: Über 600.000 Einzelfälle von Patienten liegen in der Münchner Leukämielabor GmbH (MLL) digital vor – das beinhaltet Diagnosen, Befunde, aber auch Bilddaten aus der mikroskopischen Diagnostik. „Wir haben nichts auf Papier“, sagt MLL-Geschäftsführer und Mitbegründer Professor Torsten Haferlach. Immerhin sind das alle Daten, die im MLL seit 2005 über die Routinediagnostik erhoben wurden. „Jeder Wert kann mit jedem verglichen werden“, erläutert er.
Dennoch: Künstliche Intelligenz (KI) ist das noch nicht, stellt Haferlach klar. „Wir arbeiten mit zwei Datensätzen.“ Innerhalb des Routinedatensatzes lassen sich bereits einzelne Fragestellungen nach Ein- und Ausschlusskriterien – etwa zu bestimmten Leukämietypen, nach Geschlecht oder Alter – über Algorithmen und den Vergleich mit externen Datenbanken analysieren.
„Unser Vorteil ist dabei, dass wir nicht nur eine der fünf Methoden in der Leukämielabordiagnostik, sondern alle fünf liefern“, sagt er – also Zytomorphologie, Immunphänotypisierung, Chromosomenanalyse, Molekulargenetik und Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH). Und genau hier wird es nun spannend.
Labor betreibt eigene Bioinformatik
Ein weiterer Teilbereich des Labors ist nämlich die Bioinformatik. „Auf diese Routinedaten setzen wir nun die KI drauf“, erklärt Haferlach. Denn in diesem riesigen Datensatz werden sicher Muster liegen, die man mit einer Excel-Tabelle nicht erkennen könne.
Das Münchner Labor bedient sich dazu zweier KI-Methoden: dem maschinellen Lernen und der neuronalen Netze (deep learning). 235.000 Fälle mit den Einzelentscheidungen aus den vergangenen zehn Jahren hat das MLL dafür abgespeichert. Daten mit denen das KI-Werkzeug gefüttert und trainiert wurde.
„Hierfür haben wir uns anfangs einen Partner geholt“, berichtet er. 2015 startete das Labor mit dem sogenannten „5000 Genom Projekt“ – nach mehreren Gesprächen mit verschiedenen IT-Partnern erhielt IBM mit seinem Supercomputer Watson den Zuschlag. Dabei war das Labor auch mit dem Schwergewicht Google im Gespräch.
Die Entscheidung für IBM sei auch deshalb gefallen, weil die Datenhoheit hier weiterhin beim MLL gelegen habe. Für das Aufsetzen des eigenen KI-Projekts sei diese anfängliche Starthilfe wichtig gewesen, nach über einem Jahr ist das Labor dann aber aus dem Vertrag mit IBM ausgestiegen. „Unsere Verträge waren so gestaltet, dass man bestimmte Milestones verabredet“, so Haferlach. Bei den Münchnern war hierfür ein Drei-Monats-Rhythmus vorgesehen, zu dem man dann eben auch aus dem Vertrag aussteigen konnte.
Therapiewege neu denken
Doch was leistet ein KI-Werkzeug, das das MLL mittlerweile alleine weiter trainiert und auch regelhaft zur Vorbereitung der finalen Befunderstellung nutzt? Aus der großen Datenmenge hat das Labor letztlich 5000 Fälle mit 30 spezifischen Diagnosen herausgefischt, bei denen „wir mit allen Methoden eindeutig sind“, berichtet Haferlach.
Bei bisher rund 4300 Fällen wurden anschließend die Genome sequenziert. Allein daraus sei ein Datensatz in der Größenordnung von 2,4 Petabyte (= 2.400.000 Gigabyte) entstanden. „Nur die Hardware zum Speichern würde 500.000 Euro kosten.“ „Gerechnet“ hätte man dabei aber noch nichts, dazu benötigt man riesige Arbeitsspeicher. Deshalb ging das Labor einen weiteren ungewöhnlichen Schritt: es hat die Daten in eine Cloud gelegt.
Allerdings in einem ISO akkreditierten Rechenzentrum in Frankfurt am Main, dem Amazon Web Services (AWS). „Dort gilt das neue europäische Datenschutzrecht und die Datenhoheit liegt zu 100 % immer noch bei uns. Auf der anderen Seite war uns auch klar: Auch wir hier in München könnten gehackt werden“, nennt Haferlach die Gründe.
In dieser Cloud kann sich das Labor nun die notwendige Rechenleistung zukaufen, um bestimmte Fragestellungen parallel über das KI-Werkzeug analysieren zu lassen. „Wir werfen die Genome der 4300 Fälle in die Luft und rechnen.“ Dabei könnten auch Fragen zu therapeutischen Möglichkeiten gestellt werden. „Wir können eine Diagnose natürlich im ersten Ansatz nicht ändern“, sagt Haferlach.
Die über die KI ermittelten Erkenntnisse helfen aber nicht nur bei der Befundung, sondern auch dabei, neue Pathways zu entwickeln. Und die kumulativen Erkenntnisse könnten dann auch an Pharmafirmen weitergegeben werden, damit diese eine individuellere Arzneitherapie entwickeln könnten.
Die Kosten für das KI-Projekt trägt das MLL komplett selbst. „Wir müssen in unserer Routinediagnostik so wirtschaften, dass am Ende etwas übrig bleibt“, sagt Haferlach. Der Vorteil: Es gebe keine externe Stelle, weder Venture-Kapital-Geber noch Pharmafirmen, die ein Anrecht auf die Daten hätten, die übrigens auch vom MLL immer nur anonymisiert ausgewertet werden. Allein eine Fragestellung in die KI zu geben, kostet das Labor dabei zwischen 1000 und 2000 Euro.
Für das Münchner Labor ist es aber ein Investment in die Zukunft: „In zwei bis fünf Jahren wird sich die KI zum Goldstandard in der Routinediagnostik entwickelt haben“, ist sich Haferlach sicher. „Das wird nicht nur bei uns so sein.“
Die Künstliche Intelligenz sei erfahrungs- und menschenunabhängiger – wenn die Ausgangsdaten, das Equipment und die Algorithmen stimmten. Haferlach ermutigt Ärzte daher, Künstliche Intelligenz aktiv mitzugestalten. Der Vorteil des MLL – und das spürten die Patienten und die Einsender – sei, dass es von drei Medizinern geführt werde und gleichzeitig einen interdisziplinären Ansatz biete: Im MLL arbeiten zehn Hämatologen, zwölf Bioinformatiker und 40 Molekulargenetiker. „Viele reden über KI, wir haben bereits Erfahrung damit gemacht“, sagt Haferlach – auch das eine Ermutigung an andere, sich mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen.
Die KI leistet seiner Meinung nach noch etwas: „Wir haben bestimmte Grenzen in den Klassifikationen, nach denen wir eine Diagnose stellen – zum Beispiel: bis 20 % ist es dieses, ab 21 % jenes.“ Die Künstliche Intelligenz liefere die notwendigen Informationen, um diese am Schreibtisch definierten Grenzen in der Diagnostik neu, biologisch und vor allem feiner zu setzen.
Und gerade bei der Gendiagnostik bedeute nicht jede Veränderung auch, dass sie krank machend ist. Die, die sich wenig auskennen, würden aber durchaus so befunden. Auch hier kann KI unterstützen. Zudem gehe weniger Wissen verloren: „Ich bin seit 35 Jahren Arzt“, sagt Haferlach, „wenn ich morgen tot umfalle, ist meine Erfahrung weg.“
Damit ein System trainiert wird, denn auch ein Algorithmus bzw. Technik kann Fehler beinhalten, laufen parallel Validierungsverfahren zur gängigen Diagnostik.
Die Angst vieler Ärzte, dass sie durch Künstliche Intelligenz irgendwann ersetzt werden, hält Haferlach dabei übrigens für mehr als berechtigt. Andererseits eröffnet die KI auch Chancen: „Die Ärzte haben dann auch wieder mehr Zeit für die Patienten.“ Und genau das würden sich Patienten wünschen: „Die Patienten reden gerne mit ihrem Arzt.“ KI sollte als Teil der Diagnostik daher fest in Studium und Weiterbildung verankert werden und als Hilfsmittel angesehen werden.
Aufgeschlossene Patienten
Die Patienten zeigen sich gegenüber der Forschung – auch im Bereich KI – übrigens relativ offen: Pro Tag gehen beim Münchner Leukämielabor rund 380 Proben ein, bei 45 Prozent liegt laut Haferlach das Einverständnis der Patienten für die Forschung vor. Und bei den übrigen 55 Prozent liege es häufig gar nicht daran, dass sich die Patienten verweigerten, sondern daran, dass es bei so einem sensiblen Thema wie dem Verdacht auf Leukämie nicht einfach ist, dem Patienten beim Gespräch in der Praxis oder Klinik gleich noch die Einwilligung zur Forschung nahezulegen.
Dabei hält das MLL nicht nur einen riesigen digitalen Datensatz, sondern auch eine große Biodatenbank vor – und diese befindet sich tatsächlich vor Ort in München. 1,3 Millionen Probenröhrchen lagern in München: Pro Patient werden bis zu fünf Proben aufbewahrt. „Das Einfrieren und Lagern müssen wir ebenfalls selbst finanzieren“, sagt Haferlach. Vergütet über die Diagnostikziffern werde das nicht. Dafür kann das Labor etwa zwei Drittel aller Patienten, die es je gesehen hat „zurücktracken“, wie es Haferlach nennt. Wenn ein Einsender also eine Woche oder einen Monat eine weitere Diagnosefrage hat, muss keine erneute Probe entnommen werden.
Eigene Stiftung gegründet
Um das KI-Instrument weiterzuentwickeln, setzt das MLL aber nicht nur zusätzlich auf Fördermittel durch Forschungsprojekte, sondern auch auf junge Informatik-Talente. Unter anderem hat Haferlach erst in diesem Jahr eine eigene Leukämiediagnostik-Stiftung ins Leben gerufen. Über die Stiftung können junge Forscher aus der ganzen Welt nach München kommen und mit dem 5000-Genom-Datensatz forschen.
So ein Förderprojekt kann von drei Monaten bis hin zu zwei Jahren dauern. AWS hat der Stiftung immerhin für die nächsten zwei Jahre Rechenleistung auf seinen Servern im Gegenwert von 600.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Und es gibt noch ein Standbein: Das MLL hat vergangenen Sommer das Schwesterunternehmen MLLi gegründet. Gerade erst hat die Tochter das Datenbankprojekt MLLi:db an den Start gebracht. Hierbei werden Wissenschaftlern, Forschern – vor allem Bioinformatikern –, aber auch Ärzten webbasierte Tools zur Interpretation von molekularen, zytogenetischen und immunphänotypischen Daten zur Verfügung gestellt.
Letztlich soll auch dadurch eine sicherere Befundung und zielgerichtetere Therapie ermöglicht werden. Dazu müssten sich die Forscher nur per Web einloggen und ihre Fragestellung per per Copy-and-Paste in das Datenbank-Tool eingeben, erläutert Haferlach. Ab einer bestimmten Genauigkeit der Fragen müssten sie auch Geld für die Analyse bezahlen.