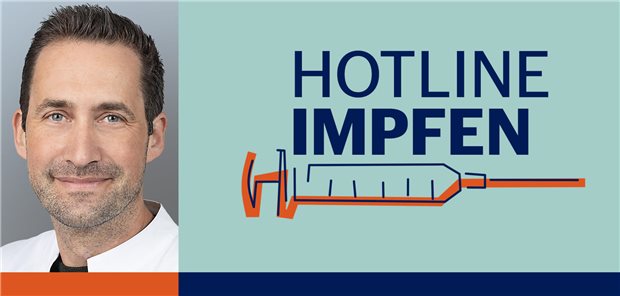Antibiotikum bessert offenbar Prognose bei ischämischer Apoplexie
HOLON (ner). Durch die Therapie mit dem Tetrazyklin-Abkömmling Minocyclin bessert sich offenbar die Prognose von Patienten nach ischämischem Schlaganfall. Die körperlichen und kognitiven Funktionen waren in einer israelischen Studie bereits nach 30 Tagen besser als bei Patienten, die Placebo erhielten. Vermutet werden neuroprotektive Effekte.
152 Patienten einer offenen Schlaganfall-Studie kamen nicht mehr für eine Thrombolyse in Betracht, weil sie erst sechs bis 24 Stunden nach Symptombeginn behandelt werden konnten. Jeweils die Hälfte dieser Patienten erhielt fünf Tage 200 mg Minocyclin oral oder Placebo. Nach der Beurteilung anhand von etablierten Scores ging es Patienten der Verumgruppe nach 30 und 90 Tagen signifikant besser als Patienten der Kontrollgruppe. Das berichten Neurologen um Dr. Yaer Lampl aus Holon in Israel (Neurology 69, 2007, 1404).
Mit Minocyclin besserte sich die Behinderung signifikant
Zu den verwendeten Scores gehören der National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), der Barthel-Index und der modified Rankin Scale. Der NIHSS etwa besserte sich von 7,5 (mittelschwere Behinderung) bei Aufnahme der Patienten in der Verumgruppe auf 1,8 nach 30 Tagen und auf 1,6 (leichte Behinderung) nach 90 Tagen. In der Kontrollgruppe gelang nur eine moderate Besserung von 7,6 auf 6,5 nach 90 Tagen.
Seit einiger Zeit wird vermutet, dass Minocyclin neuroprotektiv wirkt. Das hat weniger mit antibiotischen, als mit antientzündlichen und antiapoptotischen Eigenschaften zu tun. So weiß man aus Tierversuchen, dass die Aktivierung der Mikroglia nach Apoplexie durch Minocyclin gehemmt wird.
Auch die Produktion freier Radikale, von Stickoxid und Enzymen wie Matrix-Metalloproteinasen werden unterdrückt - alles Entzündungsvorgänge. Lampl und seine Mitarbeiter vermuten, dass unter Minocyclin-Therapie zunächst die entzündungshemmenden Effekte einsetzen. Die Zelluntergänge nach Ischämie, die bis zu vier Wochen lang anhalten, würden wahrscheinlich erst nach 48-stündiger Behandlung effektiv verhindert.
Studie ist noch kein klinischer Beweis für die Neuroprotektion
Mit der Studie sei noch kein klinischer Beweis für die Neuroprotektion erbracht, betonen die Neurologen. Dafür sei eine Doppelblindstudie erforderlich. Und: Möglicherweise könnte die Frühtherapie, eine höhere Dosierung sowie eine i.v.-Applikation die beobachteten Effekte verstärken.