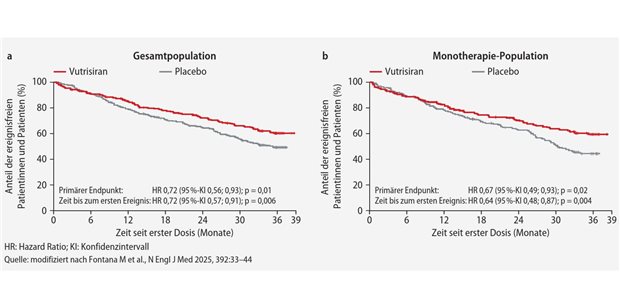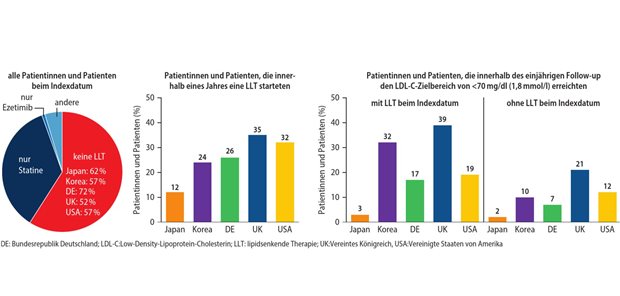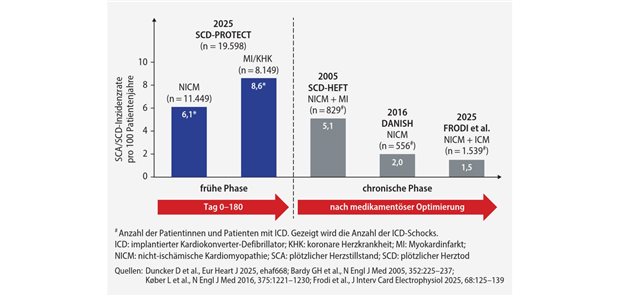Todesursachen
Kälte ist viel gefährlicher als Wärme
Ist das Wetter etwas zu warm oder zu kalt, kann das für die Gesundheit gefährlicher sein als Extrem-Temperaturen. Das hat eine europaweite Studie ergeben.
Veröffentlicht:LONDON. Kaltes Wetter ist einer Studie zufolge für die Gesundheit viel schädlicher als warmes. Für die Untersuchung haben Forscher 74 Millionen Todesfälle von 1985 bis 2012 in 13 Staaten quer über den Erdball ausgewertet.
Den Angaben zufolge ist das die bislang größte Studie zum Zusammenhang zwischen Temperatur und Gesundheit. Daten aus Deutschland wurden nicht ausgewertet; Europa war mit Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien vertreten.
Das Team um Dr. Antonio Gasparrini vom Hygiene- und Tropeninstitut in London setzte die Daten in Verbindung zu einer für jedes Land einzeln berechneten Idealtemperatur.
Das Ergebnis der Wissenschaftler: Kälte ist für etwa 20 Mal mehr Todesfälle verantwortlich als Wärme (Lancet 2015; online 20. Mai).
Kälte für 7,3 Prozent aller Todesfälle verantwortlich
Ist es zu warm, belastet das vor allem Herz und Kreislauf. Ist es zu kalt, kommen laut Studie Probleme mit den Atemwegen als weiteres Risiko hinzu, außerdem ist dann die Immunabwehr schwächer.
Kälte war der Studie zufolge für 7,29 Prozent aller Todesfälle verantwortlich, Wärme nur für 0,42 Prozent.
Aber: Extreme Temperaturen - egal ob eisige Kälte oder große Hitze - waren nur für relativ wenige Todesfälle verantwortlich. Die meisten wetterbedingten Todesfälle ereigneten sich an mäßig heißen und vor allem an etwas zu kalten Tagen. In Madrid zum Beispiel starben die meisten Menschen bei 8 Grad.
Den zweithöchsten Ausschlag hatte die Kurve bei 25 Grad. Bei extremeren Temperaturen um die Null und über 30 Grad flachte die Kurve stark ab. Die für die Gesundheit ideale Temperatur läge den Daten zufolge für Spanien um die 22 Grad.
Egal ob heiße, feuchte oder kalte, trockene Länder: Die Grafik, die Todesfälle und Temperatur zueinander in Beziehung setzt, ergibt in fast allen Klimazonen eine Art M.
Kritik an Studie: Alter und Gesundheitszustand nicht berücksichtigt
Zwei Forscher von der Duke Kunshan Universität in China bezweifeln aber die Aussagekraft der Studie in einem Kommentar (Lancet 2015; online 20. Mai).
Wichtige Faktoren für die Analyse von Todesursachen wie Alter, Gesundheitszustand, Armut oder Luftverschmutzung seien nicht berücksichtigt worden, schrieben Keith Dear und Zhang Wang.
Gasparrini und seine Kollegen sind der Ansicht, die Studie sollte die öffentlichen Gesundheitssysteme zum Nachdenken bringen. Sie dürften nicht nur extreme Wetterereignisse als Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung im Visier haben.
Klimaforscher warnen vor einer Zunahme von Wetterextremen. 2003 waren bei einer Hitzewelle europaweit Zehntausende Menschen gestorben. (dpa)