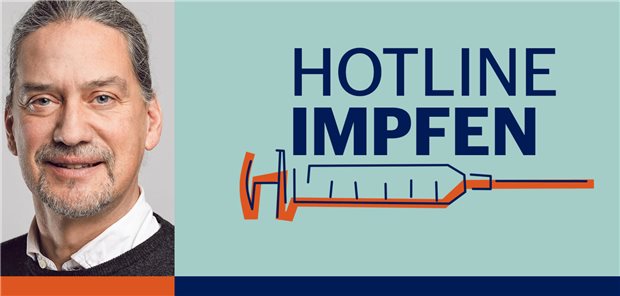Ältester Medizinpreis Deutschlands
Dr.-Martini-Preis 2023 geht dreimal ans UKE
Fünf Forscherinnen und Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf wurden mit dem Dr.-Martini-Preis 2023 ausgezeichnet. Der erste Preis wurde zweimal vergeben.
Veröffentlicht:
Ausgezeichnete Medizinforschung wird im Universitätsklinikum Eppendorf betrieben: Drei Projekte des UKE wurden jüngst mit dem Dr.-Martini-Preis ausgezeichnet.
© Axel Heimken/dpa
Hamburg. Der älteste Medizinpreis Deutschlands wurde heute fünf Ärztinnen und Ärzten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) verliehen. Dies meldet das UKE.
Der ersten Preis wurde zweimal vergeben:
- Dr. Anne Mühlig und ihre Doktorandin Johanna Steingröver, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin,
- Dr. Anastasios Giannou, I. Medizinische Klinik und Poliklinik und Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, sowie Dr. Jan Kempski, I. Medizinische Klinik und Poliklinik.
Den zweiten Preis erhielt Dr. Michael Bockmayr, Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie.
Neuen Therapieansatz bei nephrotischem Syndrom
Anne Mühlig und ihr Team konnten nachweisen, dass das Hauptsymptom des nephrotischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen, das mit erhöhter Proteinurie einhergeht, durch die medikamentöse Therapie mit Calcimimetika deutlich verbessert werden könne, heißt es in der Meldung. In ihrer Studie beschäftigen sich die Wissenschaftlerinnen mit Podozyten, die für den Aufbau und die Funktion der Blut-Harn-Schranke der Niere verantwortlich sind. Die Wissenschaftlerinnen konnten zeigen, dass der calciumsensitive Rezeptor an der Regulation des podozytären Aktinzytoskeletts beteiligt und maßgeblich für deren Funktionalität und Struktur verantwortlich sei. Daraus folgend entwickelten sie einen Therapieansatz, der die Standardtherapie der Proteinurie mit hochdosierten Glukokortikoiden künftig grundlegend verändern und so die damit verbundenen Nebenwirkungen erheblich reduzieren könnte.
Die Rolle von IL-22 bei der Metastasierung von Darmkrebs
Anastasios Giannou und Jan Kempski fanden heraus, dass Interleukin-22 (IL-22) eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Darmkrebs und der Metastasenbildung spiele, so die Meldung weiter. Il-22 sei an der Extravasation der Tumorzellen – vor allem in die Leber – beteiligt. Diese neue Erkenntnis ist insbesondere für die Nachsorge nach Entfernung eines Primärtumors mit einem hohen Risiko für die Bildung von Metastasen wichtig. Für sie könnten künftig Immuntherapien IL-22-blockierende Antikörper von entscheidendem Vorteil sein, was aber noch in klinischen Studien getestet werden muss.
Risikoeinschätzung von Rückenmarkstumoren durch bioinformatische Verfahren
Myxopapilläre Ependymome (MPE) sind seltene Tumoren des Rückenmarks, welche in allen Altersgruppen auftreten. Sie wurden bisher als eher benigne angesehen, aber insbesondere bei jüngeren Betroffenen treten häufiger auch Rezidive auf. Michael Bockmayr konnte mithilfe von molekularbiologischen und bioinformatischen Verfahren die Tumoren in zwei wesentliche Subtypen – MPE-A und MPE-B – unterteilen, schreibt das UKE. Dabei stellte er fest, dass bei 85 Prozent der Patientinnen und Patienten mit MPE-A-Tumoren innerhalb von zehn Jahren ein Rezidiv auftrete, während dies nur bei 33 Prozent der Patientinnen und Patienten mit MPE-B-Tumoren der Fall sei. Dies ermöglicht erstmals eine solide Einstufung, welche Patientinnen und Patienten ein erhöhtes Rezidivrisiko haben und deshalb eine entsprechende Nachsorge erhalten sollten. Die Ergebnisse legen auch nahe, dass für bestimmte Tumoren eine begleitende Bestrahlung oder Chemotherapie sinnvoll sein könnte. (eb/ba)