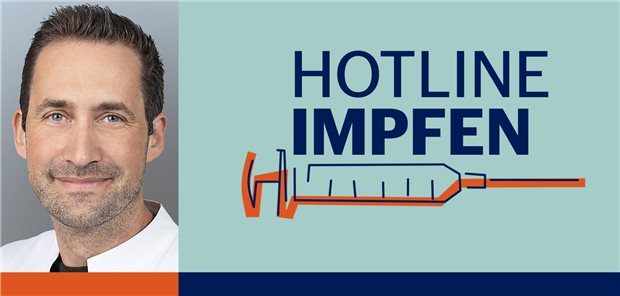Gehörlose alte Menschen oft schlecht versorgt
KÖLN (iss). Um die Versorgung von gehörlosen Menschen im Alter zu verbessern, wäre die Einrichtung von Kompetenzzentren sinnvoll.
Veröffentlicht: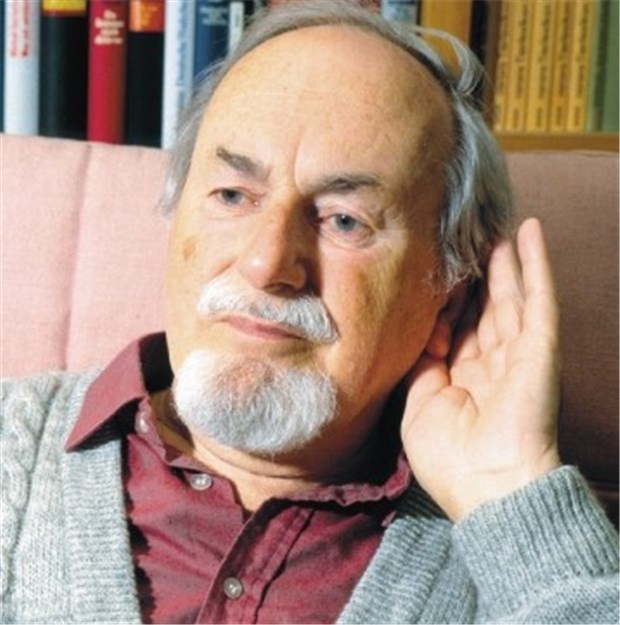
Gehörlose alte Menschen sind von vielen sozialen Kontakten ausgeschlossen. Das soll sich ändern.
© Foto: imago
Sie könnten eine Mittlerfunktion zwischen den Gehörlosen und ihren Angehörigen sowie Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, der Altenhilfe und der Behindertenhilfe übernehmen. "Das normale Spektrum für alte Menschen passt nicht für Gehörlose", sagte Professor Thomas Kaul, Dekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln, Department für Heilpädagogik und Rehabilitation, bei einer Tagung der Clearingstelle Versorgungsforschung Nordrhein-Westfalen.
Er hat mit Mitarbeitern in einem vom Bundesfamilienministerium geförderten Projekt die "Situation gehörloser Menschen im Alter" (SIGMA) untersucht. Zwar fehlten valide Daten, aber nach Schätzungen leben 16 000 Gehörlose über 60 Jahren in der Bundesrepublik, berichtete Kaul. Das familiäre Netzwerk sei bei ihnen nicht so dicht ausgeprägt wie bei anderen - zum Teil weil Gehörlose, die während des Nationalsozialismus aufgewachsen sind, zwangssterilisiert wurden. "Sie sind im Alter vermehrt isoliert", sagte er.
Zwar biete die Einbindung in die Gehörlosengemeinschaft vielen ein soziales Netzwerk. Spezielle Aktivitäten wie Seniorenclubs, Beratungsangebote oder Informationsveranstaltungen fänden sich aber meistens nur in Ballungszentren. "Bis auf das, was die Vereine anbieten, gibt es keine Angebote für Gehörlose im Alter", sagte Kaul.
Die allgemeinen Informationen für alte Menschen seien aufgrund der sprachlich-kommunikativen Probleme von vielen nicht abrufbar, auch zu instutionalisierten Angeboten wie Altenheimen oder die ambulante Pflege hätten sie nur begrenzt Zugang. In der Bundesrepublik gibt es nach Angaben von Kaul eine einzige Beratungsstelle für diese Zielgruppe und einige wenige Altenheime, in denen zum Teil gehörlose Pflegerinnen und Pfleger arbeiten. "Gehörlose Menschen im Alter sind potenziell einem höheren Risiko der Vereinsamung ausgesetzt, es gibt keine angemessene Begleitung", sagte er.
Hier könnten regionale Netzwerke Abhilfe schaffen, die bestehende Angebote für Gehörlose mit Beratungsstellen für Ältere verknüpfen, etwa mit Pflegestützpunkten. "Es müssen Informationen bereit gestellt werden, die den spezifischen Bedürfnissen entsprechen", forderte Kaul.
Langfristig notwendig sei auch die Qualifizierung von Beratern, Pflege- und Betreuungspersonal. Darüber hinaus müssten Lösungen für spezifische Fragestellungen wie die Diagnose und Behandlung von Demenzerkrankungen bei Gehörlosen gefunden werden. "Die normalen Instrumente des Assessments passen nicht."