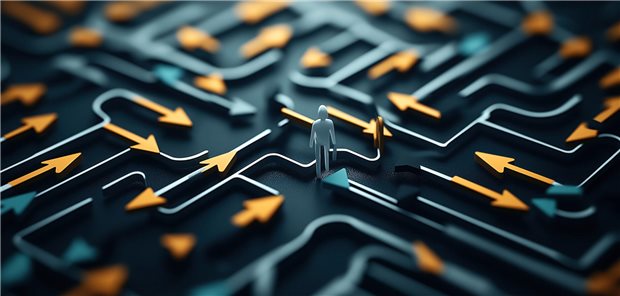Gesetzespläne
Primärarztsystem: Hofmeister warnt vor „holzschnittartigen Lösungen“
Patientensteuerung über hausärztliche Praxen? Gute Idee, findet die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das Angebot müsse aber freiwillig sein – und es habe Ausnahmen von der Regel zu geben, so Vorstandsvize Hofmeister.
Veröffentlicht:
„Patienten zur richtigen Zeit in die richtige Versorgungsebene bringen“: KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister.
© Marc-Steffen Unger
Berlin. Patienten über ein Primärarztsystem besser steuern? Der Ansatz, der auch den Koalitionsvertrag schmückt und 2026 in einen Gesetzentwurf gekleidet werden soll, hat durchaus Charme.
Einfach in der Umsetzung werde die Sache aber nicht, gibt der Vorstandsvize der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Stephan Hofmeister, zu bedenken.
„Wir haben nicht umsonst von vornherrein gesagt, dass das ein sehr wichtiges Thema, aber gleichzeitig eines mit hoher Verantwortung ist“, sagte Hofmeister diese Woche vor Journalisten in Berlin. „Holzschnittartige Lösungen“ seien fehl am Platz.
Variante Gatekeeper? Wohl kaum!
Zunächst müsse man sich verständigen, was mit Steuerung gemeint sei. „Eine Variante ist die Verknappung des Angebots: Flaschenhals Richtung Bürgerinnen und Bürger – und irgendeiner sitzt da vorne als Gatekeeper.“
Eckpunktepapier
Primärarztsystem: AOK setzt auf Teampraxis
Das sei Steuerung, wie sie etwa in Skandinavien praktiziert werde. Dass die hiesige Politik den „Mut“ aufbringe, das Modell zu kopieren, bezweifele er.
Dass Patientensteuerung ambulante Versorgung kostengünstiger mache, sei ebenfalls unwahrscheinlich, so Hofmeister. Kosten für Medikamente und Diagnostik explodierten – „billiger“ werde das System also nicht. Patientensteuerung könne aber helfen, Versorgung nachhaltiger zu machen.
Bedeute: „Wir müssen versuchen, Patienten und Behandler optimal zusammenzubringen und nicht den Patienten zur falschen Zeit am falschen Ort in der falschen Behandlungsebene zu haben.“ Besonders geeignet für eine Steuerung seien hausärztliche Praxen – keine Frage.
Ausnahmen von der Regel
Ein Primärarztsystem verpflichtend aufzusetzen, habe aber Tücken, so Hofmeister: Alle wollten doch zum „netten Primärarzt“ gehen und nicht zu dem, den keiner leiden könne. Schlussendlich müsse man nach PLZ zuweisen, weil der eine Kollege oder die eine Kollegin schlechterdings nicht 2000 Patienten und der beziehungsweise die andere nur 100 behandeln könne.
Setze man das Primärarztsystem freiwillig auf, handele es sich um „einen Tarif“. Auch die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) in Baden-Württemberg sei ein Tarif. Insofern stünden die Krankenkassen in der Verantwortung, solche Tarife – Hausarzt-First-Tarif, Orthopäden-Tarif etc. – gemeinsam mit der Vertragsärzteschaft aufzusetzen.
Klar sei auch, dass es Ausnahmen von der Steuerung über die Hausarztpraxen brauche: etwa für den Besuch beim Augenarzt, beim Psychotherapeuten oder für Chroniker, die sich regelmäßig in fachärztlicher Behandlung befinden. Ein Patient etwa, der zur Dialyse gehe, müsse nicht nur für eine Überweisung den Hausarzt aufsuchen.
Ausbau der 116 117
Mit Blick auf Akutfälle wiederum zeige sich, dass die Versorgungsplattform der 116 117 das „passende Angebot“ sei. Laut einer Umfrage sei die Hotline bereits 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürgern bekannt.
Da die Nummer im Koalitionsvertrag erwähnt sei, biete die KBV der Politik an, die 116 117 zu einer bundesweiten Plattform für „Terminvermittlung und Versorgungssteuerung“ auszubauen. Freilich: Die KBV will dieses Upload mit staatlichen Geldern gestützt wissen, wie Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner betont.
Mit einem „Praxiszukunftsgesetz“ ließen sich nicht nur Investitionen in die technische Infrastruktur der 116 117 abstützen, sondern die Praxen obendrein bei Digitalisierung unterstützen, sagte Steiner ebenfalls diese Woche in Berlin.
So habe es die Politik auch bei der Digitalisierung der Krankenhäuser gehandhabt – siehe Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das 2020 verabschiedet und über das den Kliniken 4,3 Milliarden Euro für Digitalisierung bereitgestellt worden sei. (hom)