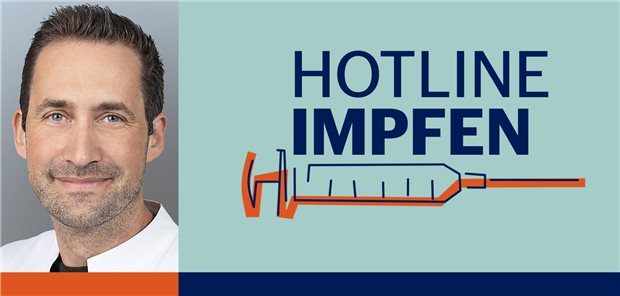Wie man Zitronen presst
Neben die indirekte Preisregulierung durch Festbeträge ist seit 2003 auch der Wettbewerb durch vereinbarte Rabatte getreten - in vielen Varianten.
Veröffentlicht:Einheitliche Arzneimittelpreise, einheitliche Zuzahlungen für alle Versicherten aller Krankenkassen: Dieses Paradigma galt ordnungspolitisch bis 2002. Bis dahin versuchte der Gesetzgeber, die Arzneimittelausgaben durch Festbeträge (1989 eingeführt) und durch Arzneimittelbudgets (von 1993 bis 2001) zu steuern. Ab 2003 folgten gesetzliche Rabatte zunächst für Arzneimittel ohne Festbetrag, schließlich für alle Arzneimittel.
Ein ordnungspolitischer Paradigmenwechsel kündigte sich mit dem Beitrags-Sicherungs-Gesetz an, das 2003 in Kraft trat. Der Grund war die Vermutung, dass Zwangsrabatte oder auch Erstattungsgrenzen wie die Festbeträge nicht vollständig die Preissenkungsmöglichkeiten ausschöpften, die bei einem harten Preiswettbewerb hätten erwartet werden können. Erstmals wurde mit diesem Gesetz eine grundlegende Strukturreform in der GKV-Arzneimittelversorgung eingeleitet: Wettbewerb als Steuerungsinstrument, damit aber auch je nach Kasse und Region unterschiedliche effektive Preise und - wie heute zu beobachten - auch unterschiedliche Selbstbeteiligungs-Modalitäten. Konkret: Rabattverträge zwischen Einzelkassen, Kassenverbänden und Herstellern.
Es gibt keine einheitlichen Konditionen mehr.
Bis allerdings der Wettbewerb wirksam werden konnte, mussten etliche Instrumente zugeschaltet oder angepasst werden. Die erste Voraussetzung wurde im Herbst 2001 geschaffen: Die Apotheker erhielten die seit langem gewünschte Aut-idem-Regelung, das Recht, wirkstoffgleiche Arzneimittel auszutauschen, es sei denn, der Arzt untersagt dies ausdrücklich. Der Gesetzgeber verband dies mit der Hoffnung, Apotheker würden in der Folge im Regelfall preisgünstige Arzneimittel abgeben.
Doch Apotheker sind auch Kaufleute. Sie richteten sich vor allem danach, wie viel an Naturalrabatten ihnen Generika-Hersteller zu liefern bereit waren. Und Kaufleute saßen auch bei den Pharma-Firmen: Warum sollten die der GKV Rabatte gewähren, wenn die Kassen ihrerseits überhaupt keinen Einfluss hatten, welche Medikamente ihre Versicherten bekommen?
Eine feste Euro-Handelsspanne (WSG 2007) und das Verbot der Naturalrabatte (AVWG 2006) schufen schließlich die Voraussetzung für eine Rabatt-Konjunktur, die schlagartig im Frühjahr 2007 einsetzte. Eine Herausforderung für Ärzte und Apotheker. Sie, die Kassen und die Hersteller haben inzwischen gelernt, wie man Zitronen presst. Wie die neue Generation der Rabattverträge aussieht, lesen Sie in diesem Special.
Lesen Sie dazu mehr: Special Rabattverträge