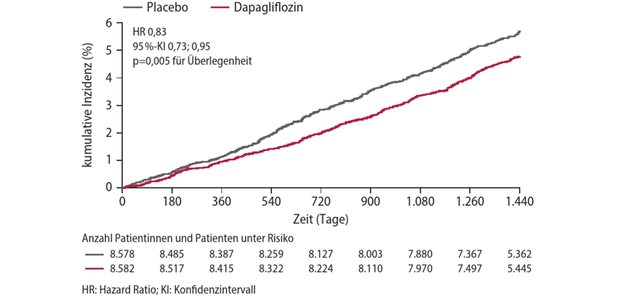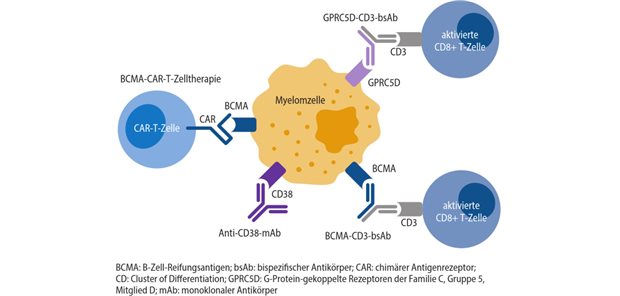Nach einer Transplantation ist das Risiko für Hauttumoren sehr hoch
WIESBADEN (nsi). Bevor der Allgemeinarzt einen Patienten auf die Warteliste für ein neues Organ setzen lässt, sollte ein Dermatologe klären, ob ein erhöhtes Risiko für Hauttumoren besteht. Denn bei der Wahl der immunsuppressiven Medikamente ist es wichtig, das Hautkrebsrisiko zu berücksichtigen.
Veröffentlicht:"Zehn Jahre nach einer Nierentransplantation hat fast jeder Patient ein invasives Plattenepithel- oder Basalzellkarzinom." Darauf hat Dr. Claas Ulrich beim 113. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden hingewiesen. Der Dermatologe von der Charité Berlin hat sich auf die Betreuung von Menschen mit einem fremden Organ spezialisiert. "Die hohe Rate an invasiven Hauttumoren unterminiert die Erfolge der Transplantationsmedizin", so Ulrich.
Das belegt eine Studie des United Network of Organ Sharing (UNOS) mit 33 000 Patienten, die eine Spenderniere bekommen hatten. Demnach sinkt die Rate der Hauttumoren um 59 Prozent innerhalb von zwei Jahren, wenn mTOR-Hemmer (mammalian target of rapamycin) verschrieben und Calcineurin-Hemmer eingespart wurden. In Deutschland liegt die kumulative Inzidenz für Hauttumoren drei Jahre nach Transplantation bei 7,4 Prozent.
Bei aktinischen Keratosen kommt es schnell zu Tumoren
Besonders anfällig sind Patienten, die bereits vor der Organübertragung Frühformen einer aktinischen Keratose haben. Bei ihnen können während der Immunsuppression in kurzer Zeit Hauttumoren wachsen. Patienten mit einem hohen Risiko sollten auf einen mTOR-Hemmer eingestellt werden, so Ulrich bei der vom Unternehmen Novartis Pharma unterstützten Veranstaltung. Denn mTOR-Hemmer (Proliferationssignal-Hemmer; vom Unternehmen gibt es Everolimus als Certican®) sind mit einem deutlich erniedrigten Risiko für Tumoren der Haut assoziiert.
Ebenfalls zu erwägen sei eine Immunsuppression mit einem mTOR-Hemmer bei Transplantat-Empfängern, die sich in der Vergangenheit viel in der Sonne aufgehalten haben.
Weitere Kandidaten für eine Therapie mit diesen Medikamenten sind Patienten, die eine lange Lebenserwartung mit dem neuen Organ haben. Das ist zum Beispiel bei denjenigen der Fall, die zum Zeitpunkt der Transplantation Mitte 40 oder Anfang 50 sind.
Allerdings müssten die Patienten auf mögliche unerwünschte Langzeiteffekte der mTOR-Hemmer wie Fettstoffwechselstörungen hingewiesen werden.
Ebenso sollten ihnen die möglichen unerwünschten Wirkungen auf die Haut wie akneiforme Dermatitis oder Aphten in der Mundschleimhaut bekannt sein. Die unerwünschten Effekte ließen sich immerhin gut behandeln, sagte Ulrich.
"Der Hausarzt bleibt auch in der Nachsorge ein wichtiger Ansprechpartner. Er sollte Transplantat-Empfänger immer wieder darauf hinweisen, dass sie sich besonders vor der Sonne schützen müssen. Und außerdem sollte er ihnen raten, sich mindestens einmal im Jahr von einem Dermatologen untersuchen zu lassen", sagte Ulrich beim Internisten-Kongress in Wiesbaden.








![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)