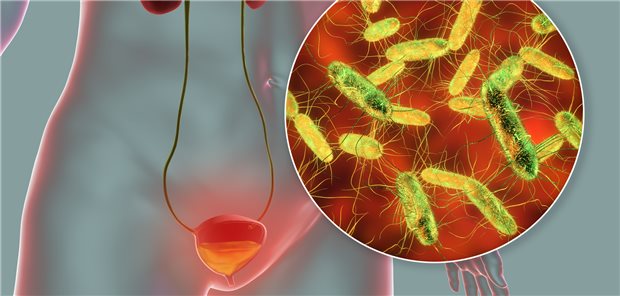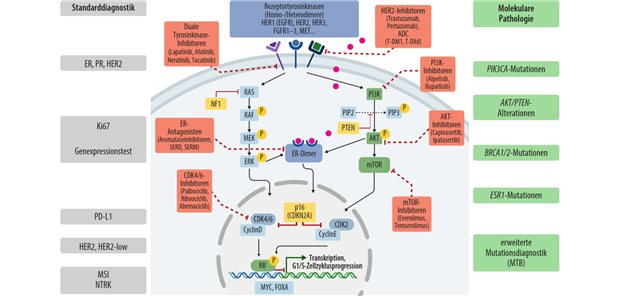Mehr Interesse an der Fortpflanzungsmedizin!
Fortpflanzungsmedizin ist gut für Schlagzeilen. Doch meist überwiegen die reißerischen, effekthascherischen oder gar schlechten. Dementsprechend werden Themen wie Klonen, "Designerbabys" oder Schwangerschaft bei lesbischen Lebensgemeinschaften gerne von der veröffentlichten Meinung wahrgenommen, weitaus weniger freilich die tägliche Routine dieses Fachgebietes. Doch gerade das würde sich lohnen.
Denn schon jetzt erblicken in Deutschland pro Jahr zwischen 12 000 und 13 000 Kinder das Licht der Welt, die durch Verfahren wie IVF (In-vitro-Fertilisation) oder ICSI (intrazytoplasmatische Spermieninjektion) gezeugt wurden. Und die Tendenz ist steigend.
Bei der Fortpflanzungsmedizin wird kaum wahrgenommen, daß es sich hier um ein weites Fachgebiet handelt, das praktisch alle anatomischen, hormonellen, immunologischen, funktionellen, genetischen und psychosomatischen Störungen der Fortpflanzung (und auch der Paarbeziehung) zum Inhalt hat; als Beispiele seien genannt Frauen ohne Eileiter, solche mit einer ausgedehnten und vielfach operierten Endometriose, Männer mit Querschnittslähmungen oder nach einer Tumoroperation. Dementsprechend vielfältig ist die Fortpflanzungsmedizin in ihren Ausbildungsvorgaben und Anforderungen.
Zum Schwerpunkt in der Frauenheilkunde erklärt
Und so hat der Deutsche Ärztetag auch erst unlängst entschieden, daß "gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin" den Rang eines Schwerpunktes innerhalb der Frauenheilkunde erhält, also somit nur im Rahmen einer mindestens dreijährigen Zusatzausbildung mit nachfolgender Prüfung erwerbbar ist.
Und dementsprechend gehören eben auch Erkrankungen wie die Endometriose, Myome, Uterusfehlbildungen, wiederherstellende Eingriffe an den Eileitern (oder Samenleitern) in dieses Fachgebiet, wie übrigens auch eine Ausbildung in labormedizinischen Untersuchungsverfahren sowie Grundkenntnisse der endokrinen Therapie bei Malignomen.
Ein weites Gebiet also, dem letztlich weit mehr Kinder als die oben genannten ihre Zeugung und Geburt verdanken, schätzungsweise sind es um die 60 000 bis 70 000 pro Jahr (das entspricht nahezu zehn Prozent der Gesamtgeburten in Deutschland).
Szenenwechsel. Es wird erwogen, die fortpflanzungsmedizinischen Behandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen - weil ja Zeugung von Kindern Privatsache ist. Zu einseitig wird hier die Ausgabenseite betrachtet: denn hier geht es auch um die soziologische beziehungsweise soziodemographische Entwicklung in unserem Land - Stichwort: Überalterung! Sicherung der Sozialsysteme bedeutet eben gerade, genügend junge Leute im Land zu haben, die durch ihre Arbeit hierzu beitragen können.
Diese Argumente hat man zum Beispiel bei der Debatte um das Zuwanderungsgesetz oft gehört - doch wenn es um unseren Nachwuchs geht, und besonders um die Paare, die damit Probleme haben, verstummt die Politik fast völlig.
Die betroffenen Paare verstehen dies nicht. Dies gilt um so mehr, als gerade solche Paare weit überdurchschnittlich eine konservative Lebensplanung haben, in deren Mittelpunkt nach wie vor Familie und Kinder stehen. Und oft verfügen sie auch nicht über die notwendigen Finanzen, da die Rolle der Frau stark auf Familie und Mutter zugeschnitten ist.
Von diesen Paaren werden wieder viele, wie schon gehabt, "ihr letztes Hemd geben" um sich die Behandlungen leisten zu können. Und viele werden sich wieder drei Embryonen einsetzen lassen, mit der Folge, daß die Zwillings- und Drillingsschwangerschaften rapide ansteigen.
Könnten die für Mutter und Kind risikoreichen Mehrlingsschwangerschaften nicht vermieden werden? Vorerst: nein. Denn menschliche Embryonen zeigen ein sehr schlechtes Implantationsverhalten, unabhängig von ihrer Zeugung. Von zehn gezeugten Embryonen werden nur etwa zwei bis maximal drei auch zur Geburt eines Kindes führen.
Wollte man die Erfolge der Fortpflanzungsmedizin nun steigern, dann wäre es erforderlich, jene zwei bis drei Embryonen mit einem entsprechenden Entwicklungspotenzial zu identifizieren. Dies ist heutzutage - mit gewissen Einschränkungen - durchaus möglich. Und dort wo dies getan wird, liegen die Schwangerschaftsraten deutlich höher, im Einzelfall doppelt so hoch.
Höhere Kosten durch das Embryonenschutzgesetz
Dem steht freilich in Deutschland das Embryonenschutzgesetz entgegen. Mit anderen Worten: Wer noch größere Erfolge der Fortpflanzungsmedizin wünscht, der muß das Embryonenschutzgesetz ändern. Anders ausgedrückt: Das Embryonenschutzgesetz sorgt bei uns dafür, daß Behandlungsaufwand und Kosten höher, die Erfolgsraten aber niedriger sind als dies möglich wäre und in vielen, auch europäischen Ländern gang und gäbe ist.
Und so schließt sich der Kreis: Wer über Kosten diskutiert, darf dies nicht außer acht lassen, und er muß auch wissen, daß die jetzigen gesetzlichen Vorgaben den Weg in die teuren Zwillings- und insbesondere Drillingsschwangerschaften geradezu bahnen, ein Umstand, der aus fortpflanzungsmedizinischer Sicht in keiner Weise gewünscht oder gar gerechtfertigt ist.
Keine Reaktion auf Vorschläge der Fachgesellschaften
Die Frage kann also nicht lauten: Wozu Fortpflanzungsmedizin, sondern nur noch: Wie kann man sie noch professioneller und effektiver zum Wohle der betroffenen Paare gestalten? Hier haben die Fachgesellschaften schon viele Vorschläge gemacht, die allerdings im politischen Raum bisher echolos verhallt sind.
Gleichzeitig ist die Eigeninitiative der Fortpflanzungsmedizin sehr hoch: So wird zum Beispiel über das Deutsche IVF-Register (D.I.R.) vorbildliche Arbeit geleistet, indem alle bundesdeutschen IVF- und ICSI-Zyklen prospektiv erfaßt werden, wodurch es - wie in keinem anderen Gebiet der Medizin - möglich ist, Transparenz zu schaffen und exakte Aussagen zu machen. Aber Eigeninitiative ist nicht alles. Irgendwann muß sich auch die Gesellschaft dieses für ihre Existenz so wichtigen Bereiches annehmen und ihn nicht nur dann wahrnehmen, wenn er unter "Sex and Crime" für Schlagzeilen taugt.
Professor Wolfgang Würfel aus München ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin. Dieser Beitrag erschien zuerst in "Gesundes Leben" (4/2003).