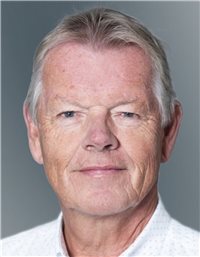Neue US-Hypertonie-Leitlinie
Hoher Blutdruck fängt jetzt bei 130 an!
US-Kardiologen haben in ihren Hypertonie-Leitlinien die Grenze für die Definition von Bluthochdruck nach unten korrigiert – zur Prävention. Die Deutsche Hochdruckliga bekräftigt hingegen ihre "moderaten" Zielwerte.
Veröffentlicht:
US-Kardiologen wollen im neu definierten Hypertoniestadium verstärkt auf Bewegung zur Blutdrucksenkung setzen.
© Getty Images/iStockphoto
Die US-Kardiologenvereinigungen American Heart Association (AHA) und American College of Cardiology Guidelines (ACC) haben den AHA-Kongress 2017 in Anaheim zum Anlass genommen, ihre aktualisierten Hypertonie-Leitlinien vorzustellen.
Das Dokument, das gleichzeitig zum Kongress publiziert wurde, ist bewusst sehr umfangreich geraten und deckt ein breites Spektrum von Komponenten des Hypertonie-Managements von Prävention über Blutdruckmessung bis hin zur Therapie ab (Hypertension 2017; online 13. November). Erstmals seit 2003 ist darin die Definition dessen, was ein hoher Blutdruck ist, modifiziert worden.
Als "hoch" werden demnach nun Blutdruckwerte von 130/80 mmHg oder höher klassifiziert. Bislang lag die Grenze wie auch in deutschen Leitlinien bei 140/90 mmHg. Für die Therapie bedeutet dies, dass der Blutdruck bei den meisten US-Patienten mit Hypertonie künftig auf Werte unter 130/80 mmHg gesenkt werden soll.
Dr. Paul K. Whelton von der Tulane University in New Orleans, Erstautor der neuen Guidelines, begründete dies auf einer Pressekonferenz damit, dass schon bei Blutdruckwerten von 130 bis 139 mmHg eine erheblich Zunahme von kardiovaskulären Komplikationen zu verzeichnen sei. Dagegen soll nun früher therapeutisch interveniert werden – nicht unbedingt gleich mit Medikamenten.
Die neue Hypertonie-Klassifikation
Im Einzelnen sieht die neue Klassifikation so aus: Als "normal" gelten auch weiterhin Blutdruckwerte von unter 120/80 mmHg.
Systolische Werte zwischen 120 und 129 mmHg (bei diastolischen Werten < 80 mmHg) werden nun als "erhöht" eingestuft. Solche Werte fielen in den alten JNC-7-Leitlinien (Joint National Committee 7) noch unter die Kategorie "Prähypertonie".
Dieser umstrittene Begriff, der bisher zur Kennzeichnung von systolischen Werten zwischen 120 und 139 mmHg (und diastolischen Werten bis 89 mmHg) diente und ein Warnsignal für Arzt und Patient sein sollte, dem Blutdruck erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, ist aus den neuen US-Leitlinien komplett eliminiert worden. Dieses Warnsignal soll künftig durch als "erhöht" gekennzeichnete Werte zwischen 120 und 129 mmHg ausgelöst werden.
Ab 130/80 mmHg beginnt nach neuer Definition der Bluthochdruck. Zuvor noch als "prähyperton" erachtete systolische Werte zwischen 130 und 139 mmHg (oder diastolische zwischen 80 bis 89 mmHg) fallen nun in das Hypertonie-Stadium 1.
Das hat zur Folge, dass systolische Werte zwischen 140 und 159 mmHg (oder diastolische zwischen 90 und 99 mmHg), die bislang das Stadium 1 markierten, künftig ebenso wie alle Werte von 160/100 mmHg oder höher dem Stadium 2 der Hypertonie zugerechnet werden.
Die neuen Therapieempfehlungen
Im Zuge der neuen Klassifikation sind auch die Therapieempfehlungen in einigen Punkten modifiziert worden. Bei "erhöhten" Blutdruckwerten (120-129/<80 mmHg) reichen demnach nicht-pharmakologische Interventionen mit dem Ziel einer gesunden Lebensweise aus (Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, eingeschränkte Natrium- und erhöhte Kalium-Aufnahme, körperliche Bewegung, moderater Alkoholkonsum).
Diese Empfehlung gilt gleichermaßen für Personen, bei denen zwar eine Hypertonie im Stadium 1 (130-139/80-89 mmHg), aber noch keine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung oder ein entsprechend erhöhtes Risiko besteht.
Dagegen sollten Personen im Hypertonie-Stadium 1, die bereits kardiovaskulär erkrankt sind oder ein deutlich erhöhtes Risiko für atherosklerotische Gefäßerkrankungen aufweisen (10-Jahres-Risiko höher als 10 Prozent), zur Primär- bzw. Sekundärprävention zusätzlich eine blutdrucksenkende Medikation erhalten. Auch bei allen Personen mit Hypertonie im Stadium 2 (>140/90 mmHg) wird eine solche antihypertensive Medikation selbstverständlich als notwendig erachtet.
Deutsche Kardiologen moderater
In Deutschland empfiehlt die Hochdruckliga, bei kardiovaskulären Risikopatienten einen Blutdruckwert von unter 135/85 mmHg anzustreben.
In den USA wird sich aufgrund der allgemein niedriger angesetzten Schwelle die Zahl der Menschen mit Hypertonie erhöhen. Whelton schätzt, dass ihr Anteil an der US-Bevölkerung von 31,9 Prozent (nach alter JNC-7-Definition) auf 45,6 Prozent (neue ACC/AHA- Definition) ansteigen wird.
Er betonte allerdings, dass der Anstieg der Zahl von Patienten, die einer medikamentösen Therapie bedürfen, ungleich geringer sein wird. Bei der Mehrheit der "neuen" Hypertoniker sei der Lebensstil primärer Ansatz für die Risikoreduktion. (Mitarbeit: eis)