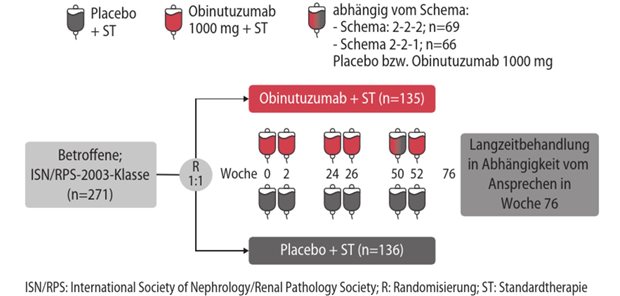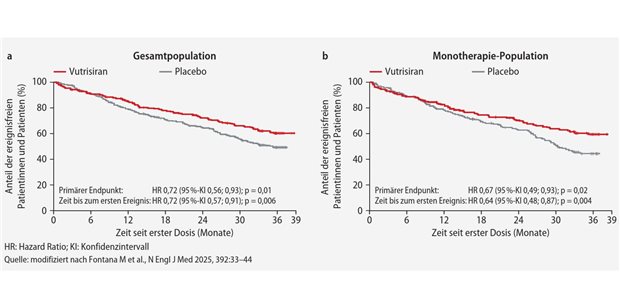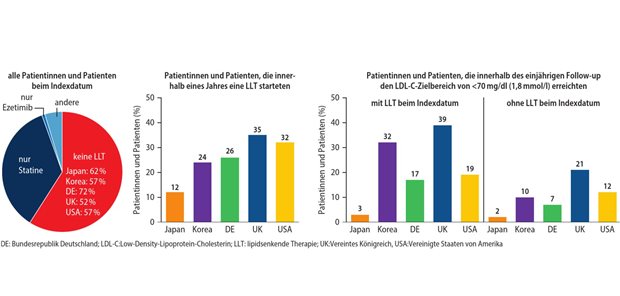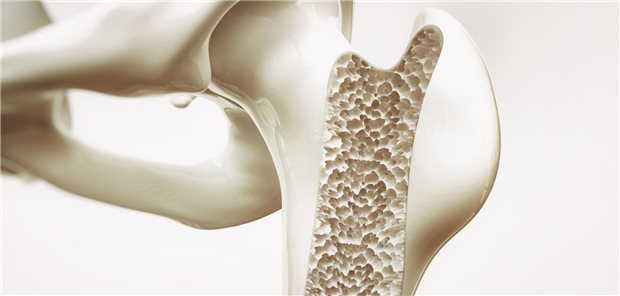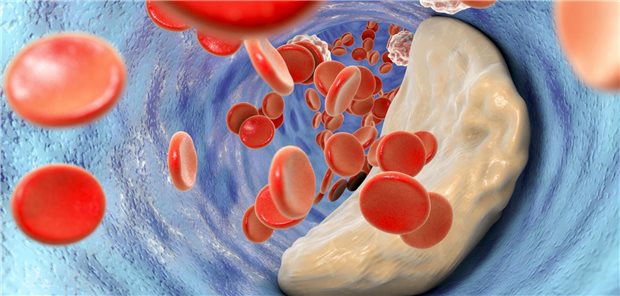HINTERGRUND
Angehörige und Strukturen in Kliniken sind in Deutschland häufig Bremser bei den Organspenden
Von Nicola Siegmund-Schultze
Woran liegt es, daß es in Deutschland seit Jahrzehnten einen chronischen Mangel an postmortalen Organspenden gibt? Schon bei den Beratungen zum Transplantationsgesetz, das Ende 1997 in Kraft getreten ist, hat diese Frage eine besondere Bedeutung gehabt, und sie konnte damals nur bruchstückhaft beantwortet werden: Lediglich etwa 40 Prozent der Krankenhäuser mit Intensivbetten, so die Schätzungen aus den 90er Jahren, beteiligen sich an der Meldung von hirntoten Menschen, die als Organspender in Frage kämen. Das war - und ist - ein Teil der Crux.
Jetzt gibt es eine Untersuchung der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) Region Nord-Ost, in der weitere Ursachen für den Organmangel differenziert analysiert worden sind. Die Studie offenbart: Nur bei der Hälfte der potentiellen Spender ohne medizinische Kontraindikationen für die Organentnahme können die Chirurgen tatsächlich explantieren. Hauptgrund für die geringe Realisierungsrate: die Ablehnung durch Angehörige.
Und trotzdem kommt die Organspende-Region Nord-Ost - sie ist eine von sieben in Deutschland - noch auf einen Durchschnitt von 20 Organspendern pro eine Million Einwohner. Sie liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt aus den vergangenen Jahren (14 bis 15 postmortale Organspender pro eine Million Einwohner).
"Eine Verdopplung der Organspenden wäre möglich"
"Unsere Daten bestätigen indirekt frühere Untersuchungen von Kollegen aus Hamburg, die ermittelt haben, daß eine Steigerungsrate der Organspenden auf etwa das Doppelte möglich wäre, wenn alle potentiellen Organspender in den Krankenhäusern auch erkannt und gemeldet würden", so Dr. Claus Wesslau, Studienleiter und Geschäftsführender Arzt der Region Nord-Ost im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung".
Denn es sei kaum vorstellbar, daß sich die Zahl der hirntoten Menschen, die als Organspender in Frage kommen, völlig ungleich über die Bundesrepublik verteilten. So ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit maximal zehn postmortalen Organspendern pro Million Einwohner seit Jahren das Schlußlicht in Deutschland.
| Angehörige stimmen einer Spende seltener als früher zu. | |
Die Region Nord-Ost erstreckt sich über Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In den Jahren 2002 bis 2004 sind dort 1502 Menschen an primärer oder sekundärer Hirnschädigung auf Intensivstationen gestorben. Bei 1349 von ihnen wäre eine Organentnahme medizinisch möglich gewesen. Während der Zeit auf der Intensivstation trat dann aber bei 409 von ihnen ein Kreislaufversagen ein. So blieben 940 potentielle Spender (40,8 pro eine Million Einwohner).
Bei 40 Prozent aus dieser Gruppe bekamen die Ärzte keine Zustimmung zur Organspende, bei weiteren knapp zehn Prozent versagte der Kreislauf um die Zeit der Hirntoddiagnostik herum. "Das bedeutet, wir müssen mögliche Spender wirklich frühzeitig erkennen und alles tun, um die Homöostase aufrecht zu erhalten", sagt Wesslau.
Insgesamt bestätigen die Daten der neuen Studie aber Wesslau zu Folge, daß es in Deutschland - ähnlich wie in den USA, Frankreich und Spanien - zwischen 40 und 60 potentielle Organspender pro eine Million Einwohner ohne medizinische Kontraindikationen geben muß. Denn es sei auch in dieser Studie nicht möglich gewesen, lückenlos alle potentiellen Organspender zu erfassen.
Bei 39 Prozent der potentiellen Spender Entnahme abgelehnt
In der Region Nord-Ost beobachten die Ärzte ebenso wie in anderen Regionen Deutschlands eine abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung, einer Organentnahme nach dem Tod zuzustimmen.
Im Jahr 2002 hatten die Ärzte in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern noch bei 62 Prozent der potentiellen Organspender eine Zustimmung erhalten, im Jahr 2004 nur noch bei 53 Prozent. Eine Tendenz, die auch im Bundesdurchschnitt zu erkennen ist: Im Jahr 2002 lag die Zustimmungsrate bei 65 Prozent, im Jahr 2004 bei fast 61 Prozent, ebenso im vergangenen Jahr.
Leitlinien in Kliniken können das Vorgehen festlegen
Die frühzeitige Erkennung potentieller Organspender in den Kliniken lasse sich durch den Kontakt zu Mitarbeitern der DSO sowie durch klare Prozeßabläufe und Behandlungsalgorithmen optimieren, resümiert die DSO.
Gemeinsam mit Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern gelte es, Leitlinien zu erarbeiten, die dann von der Klinikleitung als verbindliches Vorgehen festgelegt werden müßten. Auch Ausführungsgesetze der Bundesländer zur konkreten Umsetzung des Transplantationsgesetzes hätten sich bewährt.
Außerdem gelte es, Informationen über das Thema Organspende stärker in die Schulen zu tragen und etwa ab der zehnten Klasse als festen Bestandteil von Unterrichtsmaterialien zu etablieren, sagte Wesslau. Mehr als 90 Prozent der Angehörigen von Organspendern, die in der aktuellen Studie untersucht wurden, hätten den Willen des Gestorbenen nicht gekannt.
Weitere Informationen inklusive die Studie können per E-mail angefordert werden: presse@dso.de
FAZIT
Ein Grund für die geringe Rate von Spenderorganen in Deutschland ist, daß Angehörige die Entnahme ablehnen, so eine Studie der Stiftung Organtransplantation. Viele potentielle Spender werden zudem von Kliniken nicht erkannt und gemeldet. Hier ließe sich etwa durch strukturiertes Vorgehen die Spenderrate steigern.