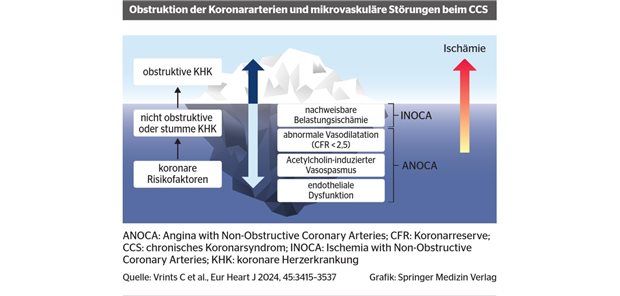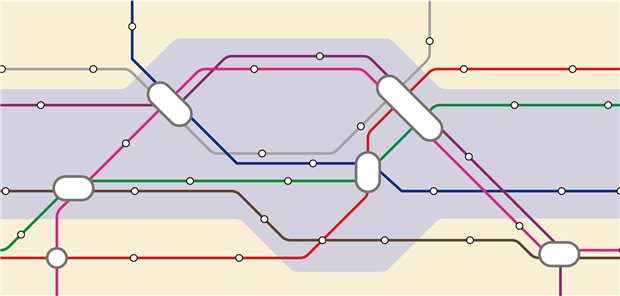Eplerenon - neue Option für die Prävention nach Myokardinfarkt
Patienten, die als Komplikation eines akuten Myokardinfarkts eine linksventrikuläre Dysfunktion entwickeln, haben ein hohes Risiko für künftige kardiovaskuläre Ereignisse. Seit Mitte September ist in Deutschland der Aldosteronantagonist Eplerenon für die Behandlung dieser Risikopatienten zugelassen. Damit eröffnet sich eine zusätzliche Möglichkeit, Mortalität und Morbidität nach Myokardinfarkt weiter zu senken.
Veröffentlicht:Peter Overbeck
Grundlage für die jetzt erteilte Zulassung bildet die im April 2003 veröffentlichte EPHESUS-Studie (Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study). Ihre Ergebnisse hat Dr. Faiez Zannad in München auf einem von Pfizer veranstalteten Satellitensymposium in Erinnerung gerufen. Zudem präsentierte er neue, bei klinisch wichtigen Subgruppen vorgenommene Auswertungen der EPHESUS-Daten.
| EPHESUS: Prävention mit Eplerenon nach Herzinfarkt | ||||
| Primäre Endpunkte |
|
|
|
|
| Gesamtmortalität |
|
|
|
|
| Kardiovaskuläre Mortalität oder Hospitalisationen |
|
|
|
|
| Quelle: B. Pitt, Tabelle: Forschung und Praxis / Ärzte Zeitung | ||||
| Der Nutzen von Eplerenon war in der EPHESUS-Studie additiv zu dem einer optimierten Standardtherapie mit ACE-Hemmern und Betablockern. | ||||
Die koronare Herzerkrankung und speziell der Myokardinfarkt ist die häufigste Ursache für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz. In prospektiven Registern wie GRACE erhobene Daten belegen, daß Patienten mit Myokardinfarkt und gleichzeitiger Herzinsuffizienz schon in der Klinik wie auch nach sechs Monaten eine etwa vierfach höhere Sterblichkeit haben als Infarktpatienten ohne diese Komplikation.
In der EPHESUS-Studie sind 6642 Patienten mit akutem Myokardinfarkt und linksventrikulärer Dysfunktion (Auswurffraktion < 40 Prozent, im Mittel 33 Prozent) randomisiert einer Behandlung mit Eplerenon (Inspra®) oder Placebo zugeteilt worden. Bei 90 Prozent bestanden klinische Zeichen einer Herzinsuffizienz.
Eplerenon ist zusätzlich zu einer Standardtherapie verabreicht worden, die bereits einen hohen Anteil von prognostisch günstigen Therapien wie ACE-Hemmer (86 Prozent), Betablocker (75 Prozent), ASS (88 Prozent) und Statine (47 Prozent) enthielt.
Rate für die Gesamtsterblichkeit signifikant um 15 Prozent gesenkt
Durch die "Add-on"-Therapie mit Eplerenon wurde im Verlauf einer im Schnitt 16monatigen Behandlung die Gesamtsterblichkeit signifikant um 15 Prozent gesenkt, berichtete Zannad. Die kombinierte Rate für kardiovaskulär bedingte Todesfälle oder Klinikeinweisungen wurde signifikant um 13 Prozent reduziert. Auch die Häufigkeit des plötzlichen Herztodes war in der Eplerenon-Gruppe um 23 Prozent niedriger als in der Placebo-Gruppe.
Überraschend war, wie früh sich der günstige Einfluß auf die Sterblichkeit manifestierte: Schon nach 30 Tagen war ein Effekt erkennbar, wobei die relative Risikoreduktion zu diesem frühen Zeitpunkt sogar ausgeprägter war als im gesamten Beobachtungszeitraum, betonte Zannad.
Eplerenon senkt bei essentieller Hypertonie den Blutdruck. Zannad und Mitarbeiter haben deshalb speziell im großen EPHESUS-Kollektiv der Infarktpatienten mit Hypertonie in der Vorgeschichte (60 Prozent aller Studienteilnehmer) die Wirkungen von Eplerenon analysiert.
In dieser Subgruppe verringerte Eplerenon die Mortalität noch stärker als im Gesamtkollektiv, nämlich um 23 Prozent. Die Zahl der kardiovaskulär bedingten Todesfälle oder Krankenhauseinweisungen sank um 16 Prozent. Die Rate für den plötzlichen Herztod war um 26 Prozent niedriger. Alle im Vergleich zu Placebo ermittelten Unterschiede erwiesen sich als signifikant.
Einen gezielten Blick haben die EPHESUS-Forscher auch auf die Subgruppe der Infarktpatienten mit sehr ausgeprägter linksventrikulärer Dysfunktion (Auswurffraktion < 30 Prozent) geworfen. Diese schwerer erkrankten Patienten profitierten in besonderem Maße von der Behandlung mit dem neuen Aldosteronantagonisten: Die Gesamtsterblichkeitsrate wurde bei ihnen durch Eplerenon um 21 Prozent, die Inzidenz des plötzlichen Herztodes um 33 Prozent reduziert. Auch diese Unterschiede zwischen Verum- und Placebo-Gruppe waren statistisch signifikant.
Daß auch die Morbidität positiv beeinflußt wurde, belegen weitere Daten. So verringerte Eplerenon die Zahl der Patienten, die wegen Herzinsuffizienz stationär behandelt werden mußten, um 15 Prozent. Selbst bei Patienten, die trotz Eplerenon-Behandlung mit Herzinsuffizienz stationär aufgenommen werden mußten, hatte der Aldosteronantagonist noch einen positiven Effekt: Er verkürzte zumindest die Dauer der während der Studienlaufzeit notwendigen Klinikaufenthalte (8,6 versus 10,3 Tage).