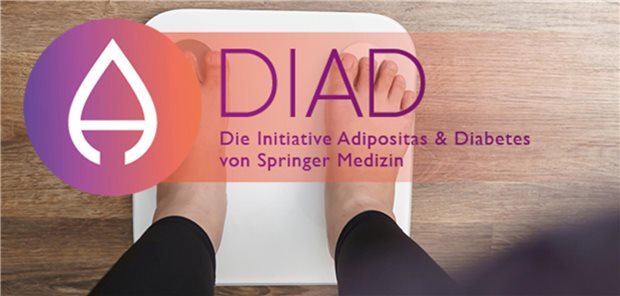GLP-1-Analoga und DPP- 4 -Hemmer: Was neue Antidiabetika zu leisten vermögen
Zu den "heißen" Neuigkeiten, für deren Präsentation die Organisatoren des diesjährigen Kongresses der American Diabetes Association (ADA) Mitte Juni in Washington eigens eine "late breaking session" anberaumt hatten, zählten aktuelle Studiendaten zur Wirksamkeit neuer Antidiabetika, die das Potential des natürlichen Darmhormons Glucagon like peptide-1 (GLP-1) therapeutisch nutzen.
Den Anfang machte Dr. Ameet Nathwani von der Novartis Pharma AG, der als zuständiger Leiter der klinischen Forschung einen Überblick zur Wirksamkeit des vom Unternehmen entwickelten DPP-4-Hemmers Vildagliptin gab. Er präsentierte zunächst Daten zur Wirksamkeit als Monotherapie. Wie die Analyse der gepoolten Daten aller einschlägigen Studien ergab, senkte die Behandlung mit Vildagliptin den HbA1c-Wert im Schnitt um 1,1 Prozentpunkte.
Je höher der HbA1c-Ausgangswert, um so ausgeprägter war die Senkung durch den DPP-4-Hemmer, berichtete Nathwani. So betrug die HbA1c-Senkung bei relativ schlecht eingestellten Diabetikern (Ausgangs-HbA1c > 9 Prozent) im Schnitt 1,7 Prozentpunkte. Die Behandlung mit Vildagliptin führte zu keiner Gewichtszunahme.
In Studien vorgenommene Vergleiche mit oralen Antidiabetika wie Rosiglitazon oder Metformin ergaben eine gleich gute Wirksamkeit.
In einer neuen Phase-III-Studie ist bei knapp 600 schlecht eingestellten Typ-2-Diabetikern die Wirkung einer Kombination aus Vildagliptin und Pioglitazon getestet worden. Je nach Ausgangswert konnte damit der HbA1c-Wert um bis zu 2,8 Prozentpunkte gesenkt werden. Nathwani sprach von einer "robusten Effizienz" des DPP-4-Hemmers, dessen Verträglichkeit der von Placebo ähnlich sei.
Je ausgeprägter die Glykämie, um so stärker die HbA1c-Senkung
Beim US-Unternehmen Merck (in Deutschland: MSD) befindet sich mit Sitagliptin ein weiterer DPP-4-Hemmer in der Entwicklung. Wie der dafür zuständige Forschungsleiter Dr. Peter Stein in Washington berichtete, hat auch Sitagliptin in mehreren Studien seine Effizienz in der Behandlung von Typ-2-Diabetikern unter Beweis stellen können.
In drei von Stein vorgestellten Studien wurde der HbA1c-Wert mit Sitagliptin (bereinigt um den Placebo-Effekt) um 0,6 bis 1,05 Prozentpunkte gesenkt. Auch die Wirkung dieses DPP-4-Hemmers erwies sich als um so stärker, je schlechter die Blutzucker-Einstellung vor Therapiebeginn war. Studien zur Kombination mit Metformin oder Pioglitazon bestätigten die additive HbA1c-senkende Wirkung von Sitagliptin.
Beide DPP-4-Hemmer scheinen im übrigen die Funktion der Betazellen im Pankreas verbessern zu können. Entsprechende Befunde liegen auch für Liraglutid vor, ein von Novo Nordisk entwickeltes lang wirkendes GLP-1-Analogon, das nur einmal täglich injiziert werden muß. Dr. Tine Vilsboll aus Kopenhagen berichtete über Ergebnisse einer Placebo-kontrollierten Studie, in der 165 Typ-2Diabetiker 14 Wochen lang mit Liraglutid in drei unterschiedlichen Dosierungen (0,65, 1,25 oder 1,90 mg pro Tag) behandelt worden waren.
In der höchsten Dosierung senkte das GLP-1-Analogon den HbA1c-Wert um 1,7 Prozentpunkte, berichtete Vilsboll. Die damit behandelten Patienten verloren im Schnitt knapp 3 kg Körpergewicht im Vergleich zum Ausgangsgewicht. Vilsboll vermutet, daß bei noch längerer Behandlungsdauer wahrscheinlich ein noch größerer Gewichtseffekt erreichbar ist. Mit Ausnahme von wenigen leichten Hypoglykämie-Episoden gab es keine Unterzuckerung in der Studie. (ob)
Darmhormon als Ansatzpunkt
GLP-1-Analoga und DPP-4-Hemmer bilden zwei neue antidiabetisch wirkende Substanzklassen, die beide auf unterschiedliche Weise die Aktivität des Darmhormons Glucagon like peptide-1 (GLP-1) steigern.
GLP-1-Analoga
Das zur Gruppe der sogenannten Inkretine zählende Hormon GLP-1 wird nach Aufnahme von Kohlenhydraten im Dünndarm produziert und in den Blutkreislauf abgegeben. Dies führt zur Steigerung der Insulinsekretion, zur Hemmung der Glukagonfreisetzung, zur Verzögerung der Magenentleerung sowie zur Appetithemmung im Zentralnervensystem. Allerdings hat das endogene GLP-1 nur eine sehr kurze Halbwertszeit.
Inzwischen wurden GLP-1-Analoga mit längerer Halbwertszeit entwickelt (Exenatid, Liraglutid). Diese müssen ein- oder zweimal täglich subkutan injiziert werden. Ein Vorteil der GLP-1-Analoga ist, daß sie kaum Hypoglykämien verursachen. Studien belegen, daß GLP-1-Analoga auch zu einer Gewichtsabnahme führen können. Exenatid ist bereits unter dem Warenzeichen Byetta® in den USA auf dem Markt.
DPP-4-Hemmer
Ein anderer Weg, um sich die Wirkung des endogenen GLP-1 nutzbar zu machen, ist die Hemmung seines Abbaus. Das Hormon GLP-1 wird durch das Enzym Dipeptidyl-Peptidase-4 (DPP-4) abgebaut. Wird DPP-4 gehemmt, bleibt GLP-1 länger aktiv. Die DPP-4-Hemmer Sitagliptin und Vildagliptin befinden sich derzeit in der klinischen Entwicklung.
Mit diesen Substanzen könnte eine für die Patienten bequeme orale Therapie ohne Gewichtszunahme und ohne Hypoglykämien möglich werden. Die bisher vorgestellten Studiendaten sprechen für eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit. DPP-4-Hemmer erhöhen nur dann die Inkretinspiegel und als Folge davon die Insulinsekretion, wenn die Darmhormone nach Aufnahme von Kohlenhydraten ausgeschüttet werden. (Rö / ob)