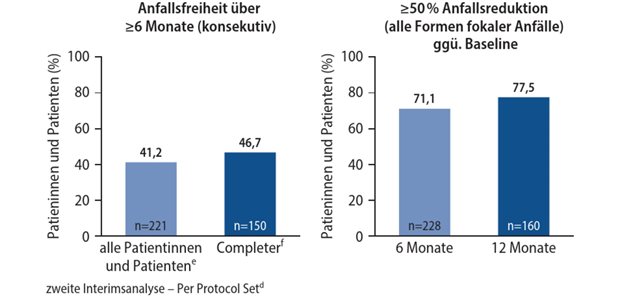Alzheimer
Plaques stören Gedächtnisbildung im Schlaf
Alzheimerpatienten leiden häufig unter Schlafstörungen, meist schon bevor sie vergesslich werden. Bekannt ist zudem, dass Schlaf bei der Gedächtnisbildung eine sehr wichtige Rolle spielt. Forscher haben jetzt einen neuen Zusammenhang gefunden.
Veröffentlicht:MÜNCHEN. Alzheimerpatienten leiden ja häufig unter Schlafstörungen, meist schon bevor sie vergesslich werden. Bekannt ist zudem, dass Schlaf bei der Gedächtnisbildung eine sehr wichtige Rolle spielt.
Forscher der Technischen Universität München (TUM) zeigten, wie sich die ß-Amyloid-Plaques im Gehirn auf die Vorgänge der Informationsspeicherung im Schlaf auswirken (Nat Neurosci 2015; online 12. Oktober).
An Tiermodellen konnten sie den Mechanismus entschlüsseln und die Störung mit Medikamenten abmildern, heißt es in einer Mitteilung der TUM.
Gelerntes wird verfestigt
Vor allem die langsamen Schlafwellen (slow oscillations) dienen dazu, Gelerntes zu verfestigen. Die Wellen werden über ein Netzwerk an Nervenzellen in der Hirnrinde gebildet und breiten sich dann in andere Hirnareale wie den Hippocampus aus.
"Diese Wellen sind eine Art Signal, mit dem sich die Hirnareale gegenseitig bestätigen ,ich bin bereit, der Informationsaustausch kann losgehen'.
Während des Schlafes herrscht daher ein hohes Maß an Kohärenz zwischen weit entfernten Nervenzellnetzwerken", erklärt Dr. Dr. Marc Aurel Busche, Forscher an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am TUM Klinikum rechts der Isar und am Institut für Neurowissenschaften der TUM in der Mitteilung.
Wie die Forscher herausfanden, ist bei Alzheimer dieser Kohärenz-Prozess gestört. Sie nutzten für ihre Studie Mausmodelle, die ß-Amyloid Plaques bilden. Die Forscher konnten zeigen, dass die Plaques direkt Störungen bei den langsamen Schlafwellen auslösen.
"Die langsamen Oszillationen treten zwar noch auf, sie können sich aber nicht mehr richtig ausbreiten - das Signal für den Informationsabgleich fehlt deshalb in den entsprechenden Hirnbereichen", wird Busche zitiert.
Balance zwischen Anregung und Hemmung muss stimmen
Den Wissenschaftlern gelang es auch auf molekularer Ebene diesen Defekt zu entschlüsseln: Damit sich die Wellen korrekt ausbreiten können, muss eine präzise Balance zwischen Anregung und Hemmung auf Nervenzellen eingehalten werden. Bei den Alzheimer-Mäusen kam dieses Gleichgewicht durch die Plaques durcheinander - die Hemmung war vermindert.
Dieses Wissen nutzten Busche und sein Team, um den Defekt medikamentös zu behandeln. Von Benzodiazepinen ist bekannt, dass sie hemmende Einflüsse im Gehirn verstärken. Verabreichten die Forscher geringe Mengen des Schlafmittels den Mäusen (etwa ein Zehntel einer Standarddosis), konnten sich die langsamen Schlafwellen korrekt ausbreiten.
Dass die Lernleistung wieder besser war, zeigten sie bei den Tieren mit Verhaltensexperimenten.Für die Forscher sind die Ergebnisse natürlich erst ein Anfang auf dem Weg zu einer geeigneten Therapie gegen Alzheimer.
"Diese Erkenntnisse sind aber aus zwei Gründen hochinteressant: erstens haben Mäuse und Menschen dieselben Schlafoszillationen im Gehirn - die Ergebnisse sind also übertragbar. Zweitens lassen sich diese Wellen mit einem normalen EEG-Gerät erfassen und somit auch Störungen schon früh diagnostizieren", fasst der Wissenschaftler in der TUM-Mitteilung zusammen. (eb)